Günter Grass ist ein liebenswerter Mann. Herr Pähler und ich haben ihn beim Kaffee letzte Woche noch als Elite Deutschen bezeichnet. Ich habe ihn aber heute Nachmittag nicht gefragt, ob er ein Elite Deutscher ist, sondern ob er sich als unbequem empfindet. Es ist schon aufregend ein Interview mit dem Schriftsteller zu führen. Er ist aber so ruhig und so unaufgeregt, dass selbst hektische Presse- und PR-Menschen für eine ungewöhnliche Sekunde inne halten. Was ich heute gelernt habe: In seinem Umfeld wird viel Du gesagt. Er schreibt grundsätzlich erst eine Handfassung, dann eine getippte Fassung auf einer mechanischen Schreibmaschine. Die hat auch einen Namen, den ich vergessen habe. Er schreibt an einem Stehpult und schaut auf eine weiße Wand. Ein Fenster würde ihn zu sehr ablenken. Günter Grass – der Unbequeme. Warum ich ihm dazu befragt habe, werde ich demnächst einmal in Ruhe berichten.
Leser-Interaktionen
Tipps
fiene & ein blick auf den appell der nrw-lokalradios vor der ukw-frequenzvergabe
Überblick
- Am Freitag entscheidet die Medienkommission über eine Vorlage der Landesanstalt für Medien NRW über elf UKW-Frequenzen im Land. Darin wird Metropol FM favorisiert. Das Domradio ist auch im Gespräch.
- Die Betreiber der NRW-Lokalradios möchten die Frequenzen für ihr Jugendradio „deinfm“ nutzen.
- Um künftig wirtschaftlich überleben zu können, fordern sie „Waffengleichheit“ mit dem WDR.
- Knackpunkt ist die nationale Werbung, von der besonders Senderfamilien profitieren: Während der WDR mit drei Programmen (1LIVE, WDR 2 und WDR 4) viele Menschen erreichen kann, müssen die Lokalradios dies mit einem Programm schaffen. Deswegen fordern sie zumindest eine weitere Welle.
Interview mit Sven Thölen, Geschäftsführer „deinfm“:
In diesem Jahr ist eigentlich ein Jubiläumsjahr. 25 Jahre Lokalfunk in NRW. Doch so richtig ist der Szene nicht nach Feiern. Strategische Posten wackeln oder sind unbesetzt. Einige Sendergruppen drohen den Vertrag mit dem Rahmenprogrammdienstleister Radio NRW zu kündigen und ziehen die Ansage wieder zurück, so erzählt man sich. In den einzelnen Redaktionen der 45 Lokalradios ist von diesen Spannungen selten etwas zu spüren. Bis zum vergangenen April habe ich noch bei Antenne Düsseldorf gearbeitet, bevor ich innerhalb der Mediengruppe an den Newsdesk der Rheinischen Post gewechselt bin.
Seit Jahren liebäugeln die Betreiber der Lokalradios mit einem landesweiten Jugendradio. „deinfm“ gehört zu dem guten Dutzend Bewerbern um die elf freien Frequenzen. So ganz hat sich mir das Bestreben der Lokalradios bisher nicht erschlossen. Warum noch eine weitere Baustelle?
In dieser Woche hat der Verband der Veranstaltergemeinschaften zusammen mit den Betreibern von „deinfm“ (die von den unterschiedlichen Betriebsgesellschaften mehr oder weniger stark gestellt bzw. unterstützt werden) zu einer Pressekonferenz eingeladen. Die Botschaft: „Frequenzvergabe gefährdet Existenz des Lokalfunk“. Gut, Klappern gehört zum Geschäft. Aber taucht man etwas in die strategische Ausrichtung von Senderfamilien und die Funktionsweise des Werbemarkts ein, wird klar, dass „deinfm“ ein wichtiger Grundpfeiler einer fundierten Zukunftsstrategie der Lokalradios ist. Wenn die Medienkommission über die elf Frequenzen entscheidet, sehen die Betreiber der Lokalradios darin je nach Ausgang ein Bekenntnis zum Hörfunkmarkt in NRW. Ein Einblick in das wirkliche Problem lohnt sich also.
Die Entscheidung
Die Medienkommission NRW ist ein staatsfernes Gremium, welches aus Mitgliedern gesellschaftlich relevanter Gruppen besteht. Die Landesanstalt für Medien NRW koordiniert die Vergabe der elf UKW-Frequenzen. Es gibt zwölf Bewerber, die 13 Hörfunkprogramme vorgeschlagen haben. Mittlerweile hat sich aber ein Bewerber zurückgezogen. Die Medienkommission kann nicht frei aus diesen Bewerbern wählen, sondern über eine Vorlage der LfM abstimmen. Am kommenden Freitag (23. Januar) kann die Kommission darüber abstimmen, ob „Metropol FM“ den Zuschlag bekommt, ein Programm vorwiegend auf Türkisch. Auch das Domradio soll einige Befürworter haben.
Beide Sender würden die bestehende Rundfunklandschaft inhaltlich ergänzen. Lediglich mit dem „Funkhaus Europa“ vom WDR sehe ich inhaltliche Überschneidungen. Allerdings kann dies auch als eine eindimensionale Betrachtung gesehen werden.
Dazu Fritz-Joachim Kock, Vorsitzender des Verbands Lokaler Rundfunk in NRW (VLR):
„Bei dieser Vergabe geht es um mehr als die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Sender. Hier stehe die Zukunft des Lokalfunks auf dem Spiel. Ich setze mich dafür ein, dass es auch weiterhin eine unabhängige lokale Berichtersattung in NRW geben wird. Die Alternative wäre ein Programm, in dem die Menschen aus der Region und das Bedürfnis nach Informationen aus ihrem unmittelbaren Umfeld zunehmend weniger Berücksichtigung finden.“
Das Problem
Warum sehen die Lokalradios sich in ihrer kompletten Existenz bedroht, wenn sie nicht den Zuschlag der Frequenzen erhalten?
Werfen wir einen Blick auf den Werbemarkt. Es gibt Einnahmen aus lokaler, regionaler und nationaler Werbung. Je nach Region sind die lokalen Einnahmen traditionell stärker oder schwächer. Die nationale Werbung ist deswegen schon immer ein wichtiger Grundpfeiler gewesen, um in allen Regionen von NRW Lokalradio anbieten zu können – auch wenn sich dies wirtschaftlich mit lokaler Werbung nicht lohnen würde.
Nur: Die Lokalradios haben derzeit ein Problem mit der nationalen Werbung.
Jan-Uwe Brinkmann, Geschäftsführer von „deinfm“ und von der Betriebsgesellschaft HSG Köln (u. A. Radio Köln):
„Bisher hat der Lokalfunk solide gewirtschaftet. Doch bis zum Jahr 2017 werden sich die finanziellen Einnahmen des Lokalfunks aus der nationalen Werbung im Vergleich zu 2007 nahezu halbieren. Die meisten unserer Lokalradiostation rutschen so in die roten Zahlen. Diesem Szenario würde die LfM mit einem klaren Bekenntnis zum Lokalfunk etwas entgegensetzen.“
Das Problem für den NRW-Lokalfunk ist der WDR. Die Kuchenstücke des nationalen Werbemarkts werden für den WDR größer, die für den Lokalfunk kleiner. Das hat nicht etwas mit dem Erfolg einzelner Sender zu tun, sondern mit dem Erfolg von Senderfamilien. Der WDR darf in drei Programmen Werbung veranstalten. 1LIVE, WDR 2 und WDR 4. Seit einigen Jahren können wir beobachten, wie die Profile der Sender geschärft werden, um unterschiedliche, aber möglichst große Zielgruppen anzusprechen. In der durchschnittlichen Stunde erreichen Werbetreibende, die die WDR-Gruppe buchen, 1,5 Millionen Hörer. Bei den NRW-Lokalradios sind es 900.000 Hörer.
Jan-Uwe Brinkmann:
„Der WDR arbeitet deutlich marktorientierter. Die Programme werden boulevardesker und entwortet. Das Mittagsmagazin von vor 20 Jahren ist heute auf WDR 2 nicht wiederzuerkennen. Der NRW-Lokalfunk darf auf dem nationalen Werbemarkt nicht bedeutungslos werden. Wir stehen zum dualen System aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Privatfunk. Wir fordern aber Waffengleichheit. Der Markt wird vom WDR dicht gemacht. Diese Chance haben wir nicht.“
Die NRW-Lokalradios haben nur einen Sender, der in die Rechnung einfliessen kann. Das Lokalradio muss nach aktuellem Stand so viele Hörer erreichen, wie 1LIVE, WDR 2 und WDR 4 zusammen – das ist schwierig. Sie wünschen sich deswegen eine eigene Senderfamilie, um wenigstens mit zwei Programmen dem WDR auf Augenhöhe begegnen zu können. Hier kommt das Jugendradio „deinfm“ ins Spiel. 60.000 Hörer sollen damit mittelfristig erreicht werden.
Der Appell an die Mitglieder der Medienkommission, dieses Branchenproblem in die Entscheidung mit einfliessen zu lassen, ist für mich nachvollziehbar.
Wenn sich ein Medium ordentlich mit dem Tagesgeschäft und der schnell fortschreitenden Digitalisierung auseinandersetzt, hat es schon genug zu tun. Wenn noch selbstgemachte Probleme hinzukommen, ist das eine Herausforderung, die selten gemeistert wird. Am Freitag könnte eine weitere hinzukommen.
fiene & erste infos zu der sender, dem ersten genossenschaftlichen sender in deutschland
Über einen interessanten Tweet bin ich gestern gestolpert:
Wir gründen den ersten genossenschaftlichen Sender in Deutschland. Helft mit, folgt @dersender und verbreitet http://t.co/rTdYnfYVsX
� Philip Banse (@philipbanse) January 15, 2015
Direkt musste ich an die Krautreporter denken. Ein ähnliches Projekt für Audio und Video, angetrieben durch den Wunsch, den Schwächen der Journalismusmaschinerie entgegenzuwirken?
Die Köpfe hinter dem Projekt sind spannend: Philip Banse (freier Hörfunkjournalist, der auch für das Deutschlandradio arbeitet), Lorenz Matzat (Datenjournalist) oder Jana Wuttke (Redakteurin von Breitband bei Deutschlandradio Kultur) sind zum Beispiel dabei. Schon alleine deswegen sollte man die Idee ernst nehmen.
Doch was ist der Hintergrund? Wie ernst nehmen die Kollegen das Projekt? Viele erste Antworten gibt es schon auf derSender.org. Aber uns reichte das noch nicht. Herr Pähler und ich haben Philip Banse eingeladen, direkt in „Was mit Medien“ die Fragen zu beantworten. Ihr könnt die Sendung vom Donnerstag nachhören und unser Gespräch findet ihr ab Minute 28. Das Gespräch habe ich auch noch einmal transkribiert:
Warum wollt ihr „Der Sender“ nicht nur starten, sondern auch zum ersten deutschen genossenschaftlichen Sender machen?
Philip Banse: Genossenschaftlich deshalb, weil wir das ganze über die Crowd finanzieren wollen. Wir sind mit dem Blog in die Vorbereitung eines Crowdfundings gestartet. Weil ihr gerade die Krautreporter erwähnt habt: Was wir aus Gesprächen mit denen mitgenommen haben, ist: Bevor sie das Crowdfunding starten zu sagen „Hey, wir haben was vor. Was habt ihr für Interessen? Was habt ihr für Kritik? Wie würdet ihr euch das vorstellen?“ Das haben die überhaupt nicht gemacht. Dann haben wir gesagt: Damit gehen wir eher rein. Wir fragen die Leute, was sie interessiert. Wir haben schon das Bedürfnis, für das Projekt einen angemessenen institutionellen Rahmen zu bieten. Da finden wir die Genossenschaft angemessen. Wir sind daran interessiert, eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen, von Leuten denen dieser Sender wichtig und am Herzen liegt.
Genossenschaft heißt, ich und jeder andere kann Genosse dieser Genossenschaft werden? Richtig formal?
Ja, das geht. Noch gibt es diese Genossenschaft nicht. Der Plan ist: Wir starten das Crowdfunding. Wenn das erfolgreich ist, werden wir eine Genossenschaft gründen. Dann kann jeder Genossenschaftsanteile zeichnen und Genosse werden.
Wir sind jetzt optimistisch, dass das Crowdfunding und die Gründung der Genossenschaft klappt: Was werden wir zu sehen und zu hören bekommen?
Wie so viele Fragen ist diese Frage noch nicht beantwortet. Wir möchten gerne einen Ort schaffen. Den haben wir zum Teil schon. Wir haben ein Studio in Kreuzberg gemietet. Dort sitzt die Firma von Lorenz Matzat drin, der Teil des Teams ist. Das ist eine schöne Fabriketage in Kreuzberg. Da würden wir mit dem crowdgefundeten Geld ein schönes Studio für Radio und Video einbauen. Je nachdem wieviel Geld reinkommt, je nachdem wer so mitmacht, je nachdem was für Konzepte uns noch ins Haus flattern, werden wir dort Sendungen machen. Unser Anspruch ist, dass wir ein möglichst breites Spektrum abdecken. Es wird Politiksendungen geben, die sich mit tagesaktuellem Geschehen beschäftigen. Es wird eine Wissenschaftssendung geben, denke ich mal. Ich fände auch die Idee eine Familiensendung reizvoll, die sich mal an Jugendliche, Kinder und Eltern wendet. Das Spektrum könnte von Drogen über Computer und Schule bis Erziehung etc. reichen. Der Anspruch ist, eine möglichst große Zielgruppe zu erreichen. Eine größere Zielgruppe, als es traditionelle Audio-Podcaster machen.
Was treibt euch an? Ist es eine publizistische Lücke, die ihr im deutschsprachigen Netzbereich seht, oder ist es die Frage, eine Organisationsform zu finden, die von klassischen Medienmarken unabhängig Journalismus ermöglicht?
Es ist sicherlich alles. Einerseits habe ich großen Spaß in den letzten zehn Jahren an der Podcasterei, die ich betreibe, gewonnen. Ich habe es schätzen gelernt, total selbstbestimmt, ohne Rücksprache mit irgendwelchen Institutionen, Themen aufnehmen und beliebiger Länge und Form und Art bearbeiten zu können. Das klingt wie eine kleine, nebensächliche Verschiebung der Rahmenbedingungen. Im Effekt macht das aber einen riesen großen Unterschied. Wenn man da eine Struktur hat, mit einem Studio, in das man sich einfach reinsetzen kann, mit einem Angestellten, der Technik und Orga übernimmt, und man damit ein Forum bekommt, um wirklich Themen, die einem selber am Herzen liegen, in freier Art nachzugehen, das finde ich reizvoll. So können wir der deutschen publizistischen Debatten den einen oder anderen neuen Twist geben.
Schauen wir mal in die USA: Ehemalige Radiomacher haben dort eigene Podcasts gestartet, aus denen ganze Mediennetzwerke geworden sind. Die sind richtige Unternehmer geworden. Sie haben Unternehmen gegründet, die sich durch Werbung finanzieren. Sie fahren ein klassisches Modell. Das können wir in Deutschland nicht beobachten. Hier gibt es am Ende immer Crowdprojekte. Ist Deutschland am Ende zu klein für so ein Unternehmertum, was die Reichweite angeht? Oder warum endet es in Deutschland immer bei der Crowd?
Die großen Podcastnetzwerke in den USA finanzieren sich ausschließlich durch Werbung. Ich glaube hier gibt es nicht die Reichweite und die Werbeinteressierte, die es strukturell ermöglichen mit dem Prinzip Werbung Massen und Gruppen zu erreichen, die für die Werbenden einen Unterschied ausmachen und für Erfolg sorgen. Das glaube ich nicht. Ich stelle nur fest, dass die Unternehmen in den USA viel engagierter sind, um einzelne Nischen und Formate einerseits zu unterstützen, und dass die Hörer dort Werbung gegenüber viel offener sind. Ich glaube, dass viele Werbeformate, die in US-Podcasts funktionieren, in Deutschland so nicht akzeptiert würden. Es gibt gleichzeitig nicht die Unternehmen, die explizit in Podcasts mit signifikanten Summen werben. Ich glaube, dass ist ein Grund, warum es hier nicht so von selbst entsteht. Der andere Grund ist einfach, dass man in Deutschland eine Tradition von unabhängigen und von Hörern finanzierten Projekten hat. Das hat hier schon Kultur.
Wir sind denn die ersten Reaktionen, nachdem ihr heute euren Plan bekanntgegeben habt?
Es war natürlich alles ganz großartig, genial und alle waren begeistert (lacht). Wir waren überrascht, dass dann doch so viel positives Feedback kam. Es kamen ein paar kritische Stimmen: Ah, wieder ein Crowdfunding-Projekt. Ah, wieder die Krautreporter für Audio und Video. Das ist völlig okay. Die Masse der Tweets und Meldungen bei Facebook waren „interessant“ und „viel Glück“ und so. Was mich am meisten gewundert hat: Es haben sich schon 15, 20 Leute gemeldet, die sich in irgendeiner Form inhaltlich, technisch, strukturell oder organisatorisch beteiligen wollen. Denen kann ich auf diesem Weg sagen: Wir sammeln das. Das habe ich denen zum Teil auch schon gemailt und getwittert. Wir verschaffen uns einen Überblick und werden uns dann melden.
Was ist der nächste Schritt?
In der nächsten Woche wird es einen Blogpost geben, in dem wir mal über Sendungen, Sendungsformate und inhaltliches Auskunft geben. Alle paar Tage werden wir dann zu unterschiedlichen Sachen etwas sagen. Zu Genossenschaften, Inhalten, Finanzierung etc. – das nächste ist ein Danke für die Beteiligung und näheres zu Sendungsformaten.
Zur Sendungsseite bei DRadioWissen.
Nichts verpassen? Hol� dir den Newsletter von Daniels Blog, um neue Einträge frisch per elektronischer Post zu bekommen. Oder abonniere den RSS-Feed.
fiene & abschied von „this week in google“
Ich plaudere mal etwas aus meinem Medienkonsum-Nähkästchen. Seit Jahren höre ich Woche für Woche den Podcast „This Week in Google“ aus dem TWIT-Netzwerk. Heute ist ein trauriger Tag: Nach sechs Jahren hört Gina Trapani als Gastgeberin auf und überlässt TWIT-Gründer Leo Laporte und Jeff Jarvis das Feld. Was für ein Verlust. Vergangene Woche kam die überraschende Ankündigung, heute habe ich die erste Ausgabe ohne Gina gehört. Auch wenn es als Ersatz tolle Gäste gibt, sind die Gespräche nie so harmonisch, wie bei der Dreierkombo Leo, Jeff und Gina. Nur in dieser Kombination, haben die Drei ihre eigenen Stärken voll ausspielen können.
Gina Trapani gibt auch die Moderation ihres Android-Podcasts ab und will sich vollständig auf ihr Startup ThinkUp konzentrieren, welches sie zusammen mit Anil Dash von Brooklyn aus betreibt. ThinkUp ist ein spannendes Analysewerkzeug, der eignen Social-Media-Kanäle analysiert. Spannend ist es nicht nur wegen der Features, sondern weil der Dienst noch auf der Suche nach seiner selbst ist. Die erste Version sah komplett anders aus – eher wie ein Backupdienst der eigenen Social-Media-Inhalte. Im letzten Jahr mussten auch einige Mitarbeiter entlassen werden. Gina hat ihren Optimismus aber behalten und lenkt ihn voll und ganz auf ihr Startup.
Bei „This Week in Google“ werde ich ihren Optimismus und ihre klugen Analysen vermissen. Für mich war der Podcast die letzten Jahre eine wichtige Informationsquelle. Mittwochabend (deutscher Zeit) ist er entstanden und meistens habe ich ihn bis zum Donnerstagabend durchgehört. „Was mit Cloud“ wäre der bessere Titel für den Podcast gewesen – die diskutierten Themen haben die wichtigsten News der Woche wiedergegeben und meinen Blickwinkel auf viele News noch einmal leicht verändert. Ich konnte News besser einschätzen und bei meiner täglichen Tech-Berichterstattung haben mir die Diskussionen in diesem Podcast weitergeholfen. Das wird mir jetzt fehlen. Zwar geht der Podcast weiter und Gina wird ab und an auch als Gast kommen – aber das ist nicht mehr das Selbe.
Danke für die vielen Stunden Talk in den letzten Jahren!
(Das Foto ist 2013 entstanden, als ich Leo Laporte in seinem Studio in der Nähe von San Francisco besucht habe.)
fiene & grindhouse homemade burgers düsseldorf
Golzheimer und Pempelforter können sich über eine neue Burgerschmiede freuen: Seit ein paar Wochen gibt es Grindhouse Homemade Burgers an der Bank-/Roßstraße.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Das Grindhouse ist kein Laden, in dem man mal eben fein Burger essen geht. Es hat nicht den Hipster-Faktor von What’s Beef, es hat nicht die Detailverliebtheit von Bob & Mary, es hat nicht die Haltung der Beef Brothers („Hähnchenburger? Sind wir hier bei den Chicken-Sisters?“). Das Grindhouse hat seine eigene Note.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Das Grindhouse ist sehr zu empfehlen. Am Ende ist es aber ein besserer Imbiss, bei dem die Kunden bedient werden. Ein Laden für den schnöden Feierabend. Ein Laden, in dem man auch mal öfter vorbeischauen kann. Schon alleine die Auswahl an elf Burgern und vier Salaten legen häufigere Besuche nahe.
Mein persönliches Highlight waren die Shakes! Der Oreo-Shake war der beste Shake, den ich in Deutschland in den letzten Jahren getrunken habe. Es gibt auch Strawberry und Vanille. In Sachen Shakes haben die anderen Burgerläden wirklich Nachholbedarf. Nicht aber Grindhouse. Auch ansonsten ist die Getränkekarte umfangreicher. Als Bier wird neben Craftbeer und Heineken als Altbier Uerige serviert. Gut. Als Pils gibt es Warsteiner. Naja. Dazu viele Weine und Long Drinks. Auch die Nachtischauswahl hebt sich ab.
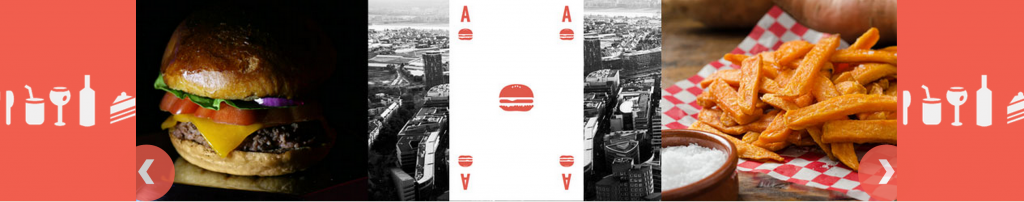
Ich hatte mir für den Smokey BBQ Burger mit Sweet-Potato-Fries und Sweet-Chili-Sauce entschieden. Der Burger war ordentlich hoch, hatte eine gute Temperatur und einen sehr guten Geschmack. Das Fleisch auf den Punkt. Das Versprechen (180g Patties. Luftgetrocknetes Dry Aged Beef lokaler Höfe. Täglich GEGRINDED. Jeden Morgen frische BUNS vom Bäcker) wurde gehalten. Vom Geschmack sortiere ich den Burger im oberen Drittel der Düsseldorfer Burgerschmieden ein. Abstriche: Leider zogen die Zwiebeln nicht nur bei mir nervige Fäden und die Tomaten schmeckten heute ebenfalls nicht nur bei mir alt. Dafür gab es einen ordentlichen, freundlichen Service und keine zu langen Wartezeiten. Ich bin ebenfalls sehr satt geworden.
Shake, Burger, Pommes, Bier für rund 17 Euro. Der Preis ist in Ordnung, dürfte aber nicht höher sein. Dafür ist die Einrichtung des Grindhouses nicht fancy genug. Für den Burger nach Feierabend ist das Laden völlig in Ordnung eingerichtet. Aber leider sind wir nunmal in Düsseldorf mit einigen anderen Länden, die teurere oder gar ähnliche Preise aufrufen, mit mehr Style verwöhnt.
Am Ende würde ich für einen Besuch im Grindhouse nicht durch die ganze Stadt fahren. Aber ich beneide die Golzheimer und Pempelforter um eine Bereicherung in ihrer Nachbarschaft.
Karte & weitere offizielle Infos: www.grindhouseburgers.de
Hinweis: Sonntags ist Ruhetag.
Nichts verpassen? Hol� dir den Newsletter von Daniels Blog, um neue Einträge frisch per elektronischer Post zu bekommen. Oder abonniere den RSS-Feed.
fiene & das waren die goldenen blogger 2014
Das waren sie: Die Goldenen Blogger 2014. Franzi, Thomas und ich haben wieder in das Internet gestreamt, um eure Stimmen für tolle Blogs zu sammeln. Wir haben die Nominierten hier vorgestellt.
Das sind die Gewinner. Wer sich für die Prozentzahlen interessiert, sie sind im folgenden Storify notiert.
Bester Blogger des Jahres:
- Isabel Bogdan und Maximilian Buddenbohm für Was Machen Die Da? http://www.wasmachendieda.de
Lebenswerk (Jurypreis)
- Jessica Weiß für ihre Verdienste um das Modebloggen bei Les Mads und Journelles
Bester Newcomer des Jahres:
- Mareice Kaiser: Kaiserinnenreich http://kaiserinnenreich.de/
Bester Blogger ohne Blog:
- Manuel Neuer
Sterbefall 2014:
- Die Kommentarfunktion bei sueddeutsche.de http://www.sueddeutsche.de
Bestes Tech-Blog des Jahres:
- iPhoneBlog.de http://www.iphoneblog.de
Bestes Satire-Blog des Jahres:
- Der Postillon http://www.der-postillon.com
Bestes Food- & Weinblog des Jahres:
- Sternefresser http://www.sternefresser.de/home/
Bestes Sportblog des Jahres:
- Mein Schweinehund und ich http://blog.wiwo.de/schweinehund/
Bestes Tagebuch-Blog des Jahres:
- Frau Nuf http://dasnuf.de/
Bester Podcast des Jahres:
- Medienkuh http://www.medienkuh.de
Bestes Lokalblog des Jahres:
- Hamburg Mittendrin http://hh-mittendrin.de/
Bester Twitter-Account des Jahres:
Bester Instagram-Account des Jahres:
Bester nichtgenutzter Messenger des Jahres:
- ICQ
Herzlichen Glückwunsch!
Es gab viele Tweets, Fotos und Reaktionen – gesammelt im folgenden Storify:
Ronny hat wieder tolle Fotos gemacht – danke!











































Schreibe einen Kommentar