
In der Facebook-Gruppe „Du bist Düsseldorfer, wenn ….“ ist mir folgendes Posting aufgefallen:
…Du Dir auf Antenne Düsseldorf immer wieder dieselben 7 Songs anhören musst. Rauf und runter. Der eine braucht Luft und die Zweite singt wie eine Ziege. Phil Collins und James Blunt wohnen in einer Zweier-WG mitten im Studio. Wir sollten alle was sammeln, um dem Sender endlich eine 2. CD zu kaufen.
😣 – Link
Für das Posting gibt es viele Likes und viele Kommentare. Ich kann viele Punkte aus Sicht der Hörer im ersten Moment nachvollziehen. Aber ich bin auch auf viele Aussagen und Vorurteile gestoßen, die einfach falsch sind. Vielleicht erklären Radiosender nicht gut genug, warum die Musik so gespielt wird, wie sie gespielt wird.
Vor zehn Jahren habe ich meine Ausbildung zum Redakteur (Volontariat) bei Antenne Düsseldorf gemacht. Seit einigen Jahren bin ich zur Rheinischen Post gewechselt, moderiere aber noch weiter montags die „Sendung mit dem Internet“. Ich bin aber auch im öffentlich-rechtlichen Radio unterwegs und habe viele andere Privatsender gesehen. Während meiner Ausbildung hatte ich ein sehr gutes Seminar bei der Musikchefin eines großen Berliner Privatradios. Dort habe ich sehr viel über Musikplanung gelernt. Das Prinzip ist bei allen großen Sendern gleich – auch wenn sie sich in Details unterscheiden. Was ich gelernt habe: Was aus der Sicht des einzelnen Hörers vielleicht keinen Sinn macht, macht aber aus Sicht der gesamten Hörerschaft Sinn.
Ich möchte gerne ein paar Behauptungen aus der Facebook-Diskussion kommentieren. Ich glaube andere Radiokollegen -egal ob öffentlich-rechtlich oder privat� kennen die gleichen Kommentare. Die Sendernamen hier im Blog lassen sich durch jeden größeren Sender austauschen. Das ist natürlich kein offizielles Statement eines Senders, aber ich denke ich kann so der Diskussion etwas helfen:
- Warum „Du Dir auf Antenne Düsseldorf immer wieder dieselben 7 Songs anhören musst.“
Die Kurzantwort auf die Frage nach der Musik im Radio lautet: Es entscheiden gar nicht die Musikredakteure mit ihrem privaten Musikgeschmack, welche Musik im Radio läuft, sondern die Hörer. Die Musikredaktionen geben immer wieder umfangreiche Abfragen in Auftrag. Marktforscher rufen dann im Verbreitungsgebiet des Senders an und spielen Titel vor: Neue Titel, Titel die bereits gespielt werden, Titel die nicht mehr gespielt werden. Es wird die Akzeptanz abgefragt. Dabei geht es nicht nur um die Beliebtheit, sondern auch um Faktoren wie die Wahrscheinlichkeit ob bei dem Song umgeschaltet wird. Oder welcher Song / Interpret mit einem Sender verbunden wird (siehe Punkt 6). Aus den Ergebnissen legen die Musikredakteure fest, welche Songs gespielt werden sollen. Welcher Song und wie häufig ein Song gespielt wird, hat also etwas mit der Akzeptanz durch die Gesamtheit der Hörer zu tun — damit möglichst viele Menschen, möglichst lange dabei bleiben. - „Das und auch nur das is der einzige Grund, weshalb ich kein Radio mehr höre. Teilweise wurde ein Song 6 x am Tag gespielt.“
Was ich rund um das Thema Musik im Radio gelernt habe: Fakten und die gefühlte Wahrheit stehen meist stark im Widerspruch. Bei Antenne Düsseldorf wurde ein Song maximal zweimal am Tag in der Hauptsendezeit zwischen 06 und 18 Uhr eingeplant. Die meisten Sender haben ähnliche Grenzen. Trotzdem haben Hörer oft das Gefühl, ein Song wird häufiger gespielt. Das hat etwas damit zu tun, dass man als Hörer bestimmte Songs mit einem Sender verbindet (siehe Punkt 4). Wenn mich ein bestimmter Song nervt und ich diesen Song über den Tag auch mal bei anderen Sendern gehört habe, dann können zwei Dinge passieren: Ich zähle den Song unterbewusst dem Sender zu, mit dem ich diesen Song verbinde, oder ich denke beim nächsten Mal, wenn der Radiosender den Song spielt „nicht schon wieder“ auch wenn der Sender den erst das erste Mal an dem Tag spielt. - „Nicht nur bei Antenne Düsseldorf läuft immer die gleiche Musik in Dauerschleife. Zuletzt bei WDR 2 habe ich das gleiche Lied innerhalb von 2 Stunden 3 mal gehört. Wenn man das auf einen 8 Stunden Arbeitstag hochrechnet, würde das immer gleiche Lied in dieser Zeit bis zu 12 mal gespielt werden. Eine grausige Vorstellung. 😠“
Musikplanung ist eine richtige Kunst. Es müssen ganz unterschiedliche Hörertypen bedient werden. Es gibt einmal die Dauerhörer, die viele Stunden am Tag hören, die Länge variiert aber meistens. Dann gibt es Hörer die nur eine kürzere Zeitspanne hören, aber dafür jeden Werktag zur gleichen Zeit. Zum Beispiel zwischen 07:35 Uhr und 08:10 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Andere hören von 06:30 Uhr bis 06:50 Uhr. Es gibt Musiktitel die von den Hörern erwartet werden (siehe Musikabfragen bei Punkt 1). Die Kunst ist es, dass im Laufe der Woche diese aus Hörersicht Pflicht-Titel mal in der 07-Uhr-Stunde auftauchen zu lassen und mal in der 06-Uhr-Stunde und am Besten auch so, dass es die Langzeithörer nicht nervt. - „Is doch überall so. Zwischendurch mal wechseln oder damit leben.“
Wenn es nur um die Musik geht, ist das der größte Fehler, den man machen kann. Ich verstehe Leute nicht, die bei jedem Song im Radio umschalten, den sie nicht mögen. Das ist zu kurz gedacht: Dann ist die Chance sehr groß, dass dieser Song bei dem anderen Sender eher wieder gespielt wird, als bei dem alten Sender. Denn dort wurde er ja gerade erst gespielt. Es gibt noch einen weiteren Grund: Man verbindet bestimmte Titel mit einem Sender (siehe Punkt 2). Wenn man den Titel dann bei einem anderen Sender hört, dann kann es passieren, dass man unbewusst den Song einem anderen Sender zu schreibt, oder genervter ist, wenn man den dann dort auch wieder hört. - „Ich denke, dass die Radiosender am häufigsten die Musik spielen, für die sie von den diversen Musikverlagen, Plattenfirmen und Künstlerargenturen das meiste Geld erhalten.“
Das ist definitiv falsch! Wenn Radiosender anfangen würden Geld von Plattenfirmen zu nehmen und die Plattenfirmen dafür die Playlisten planen würden, dann würden uns ganz schnell die Hörerzahlen einbrechen — weil Musik eben ein so sensibles Thema ist. Damit würden auch ganz schnell die anderen wichtigen Werbegelder einbrechen. Oder anders ausgedrückt: Es ist das bessere Geschäftsmodel auf Werbung zu setzen und nicht auf die Musikbranche � von ethischen Motiven mal abgesehen. - „Andreas Burani hat glaube ich auch einen Vertrag mit Antenne, so gut er auch ist aber 5-8 mal am Tag verleidet einem jeden Sänger“
Andreas Bourani (mit o) hat keinen Vertrag mit Antenne Düsseldorf der vorgibt wie oft er am Tag gespielt wird (siehe Punkt 1). Aber anscheinend haben die NRW-Lokalradios einen guten Job gemacht, die Titel von Andreas Bourani mit dem eigenen Sender zu verbinden. Wenn Titel ganz neu eingeführt werden, werden diese extra erwähnt. Wie zum Beispiel „Neu für den Sektor“ bei 1Live. - „Die Musik auf WDR 2 ist schon lange dem Rotstift zum Opfer gefallen, die Musikredaktion jedenfalls kann man nicht für die dauernde und dauerhafte Wiederholung völlig belangloser Songs loben.“
Meine These: Ich glaube WDR2 (und die anderen Musikwellen) geben deutlich mehr für Musik aus, als noch vor einigen Jahren. Die WDR-Wellen müssen inzwischen sehr viel Geld für die Musikforschung ausgeben. Die Sender sind sehr gut aufeinander abgestimmt, sodass die Wellen zusammen möglichst viele Hörer erreichen können. Da hat es der WDR deutlich einfacher, als der NRW-Lokalfunk. Die Lokalradios können nur mit einem Musikprogramm um die Hörer werben können. - „Die Playlists erstellen Agenturen, die kassieren auch reichlich und es gibt Listen von Stücken die gespielt werden müssen damit ihr auch brav das vorgesehene kaufft. Der WDR Hat genügend Geld.“
Die Playlisten werden von Musikredaktionen erstellt. Das machen keine externen Agenturen. Siehe Punkt 5.Jetzt kommen ein paar Punkte, die sich auf Nordrhein-Westfalen beziehen: - „Aber kommt die nicht meist aus der Zentrale der Lokalradios in OB ? Wenn du mal die Sender durchläufst hörst du dort, auf Neandertal und auf NE die gleiche Musik. Nur evtl mit anderen Kommentatoren.“
Guter Punkt: Warum läuft auf den Lokalradios in NRW die gleiche Musik. Die Zentrale in Oberhausen in Radio NRW ist in Wirklichkeit ein Dienstleister, auf den sich die Betreiber der Lokalradios in NRW geeinigt haben. Es gibt Dinge, die muss nicht jeder Sender selber machen: Nicht alle 45 Lokalradios müssen einen Reporter im Landtag haben. Es reicht auch wenn das ein Reporter für alle Stationen macht. Dafür gibt es dann mehr Kapazitäten für Reporter die im eigenen Ort recherchieren und arbeiten. So ist das auch mit der Musik: Gute Musikforschung und Planung sind teuer (siehe Punkt 1). Deswegen wird das auch gemeinsam gemacht. Die Erfolge beim Hörer hat man aber nur, wenn man die Musik möglichst gut über den Tag und über die Woche verteilt (siehe Punkt 3). Wenn jeder Sender spielen würde, was er wollte, könnte man sich nicht die Musikforschung sparen. Die Hörerzahlen würden sofort einbrechen. Noch ein Punkt zu Radio NRW: Dem Dienstleister gehören die Lokalradios nicht. - „Antenne Düsseldorf, unser Lokalsender, sollte aus diesem Radioverbund austreten, sich erheben und laut schreien : ‚Nein !!! Wir spielen keinen Blunt und keinen Collins mehr. Wir haben Luft genug und geben unseren Hörern, was sie wirklich hören wollen !'“
Ich fürchte die bittere Wahrheit ist: Antenne Düsseldorf würde dann seine Marktführerschaft verlieren. Es gibt ja beispielsweise auch den Bürgerfunk: Dort läuft ganz andere Musik. Was andere Hörer mir immer sagen: Sie finden den Bürgerfunk grundsätzlich gut, schalten aber doch ab, weil sie die Musik nicht mögen. - „Ist ausserdem kein Stadtsender sondern gehört zu einer Kette. Ist eher wie Aldi-Radio. Und das die an der Musik sparen ist doch logisch. Die Moderatoren sind übrigens nicht angestellt, sondern Freiberufler…ich höre die jedenfalls nicht.“
Richtig ist: Antenne Düsseldorf ist kein Stadtsender (wohl für die Stadt, aber nicht von der Stadtverwaltung). Antenne Düsseldorf gehört auch nicht wirklich zu einer Kette. Der Sender ist zwar Teil des NRW-Lokalradio-Netzwerkes, aber das sind Geschäftspartner und keine Kette wie Aldi-Süd oder Aldi-Nord. Jedes Lokalradio besteht aus einer Veranstaltergemeinschaft (das ist ein Verein!) und einer Betriebsgesellschaft, hinter der meist regionale Verlage stecken. Bei Antenne Düsseldorf sind übrigens viele Moderatoren fest angestellt. Beim WDR ist das abder anders: Die bekannten Stimmen dort sind mehrheitlich Freiberufler. - „Warum kann eine reiche Stadt wie Düsseldorf nicht einen wirklich-lokalen-unabhängigen Sender betreiben ? Für die Tour de France war doch auch genug Kohle übrig ? Auch wenn das Beispiel etwas hinkt.“
Ganz ehrlich? Wenn die Stadt Düsseldorf einen Sender betreiben würde, dann gäbe es dort nur Jubelmeldungen und keine Kritik. Wer sich den Nachrichtenbereich auf Duesseldorf.de oder in der offiziellen Stadt-App anschaut, der findet dort zwar Infos zu Sperrungen oder wenn es gute neue Dinge gibt — aber wenn es im Rat Kontroversen zum Beispiel über die Finanzpolitik der Stadtspitze gibt, dann sucht man die dort vergebens. Ich persönlich halte das Rundfunk-Modell in NRW für eins der unabhängigsten, die in unserem Mediensystem möglich sind. Die Journalisten eines Lokalradios sind bei keinem Konzern, sondern bei einem unabhängigen Verein angestellt (siehe Punkt 11). Die Mitglieder des Vereins sind Privatpersonen, die von gesellschaftlich relevanten Gruppen benannt werden. So entsteht sogar eine Unabhängigkeit von den örtlichen Verlegern. - „Antenne hat leider keinen Einfluss auf die gespielten Songs. Diese werden von Radio NRW vorgegeben. Und da diese auch ein Monopol auf Privatsender haben, wird sich da leider nichts ändern. Neue Privatsender sind nämlich nicht erwünscht. In anderen Bundesländern sieht das ganz anders aus!“
Habt ihr euch mal die Privatrundfunklandschaft in anderen Bundesländern genauer angesehen? Mehr Privatradios heißt nicht unbedingt, dass die Musik unterschiedlicher wird. Aufgrund des entstehenden Kostendrucks �da man sich den Werbemarkt ja aufteilen muss� gibt es in den anderen Bundesländern landesweite Programme, die sich keine oder nur wenige Lokal- oder Regionalstudios leisten. Insgesamt arbeiten in diesen Bundesländern deutlich weniger Hörfunk-Journalisten vor Ort. - „Denen man nichtmal wiedersprechen darf. Da wird man mitunter von Antenne angeschrieben das ob bashing zu unterlassen wenn man Kritik übt.“
Aus meiner Redaktionserfahrung weiß ich: Gegensätzliche Meinungen sind sogar ausdrücklich erwünscht! Leider können einige Hörermeinungen aber nicht vorgelesen oder abgespielt werden, wenn diese nicht sachlich, sondern beleidigend sind — oder sich anderweitig im Ton vergreifen. - „Aber echt Antenne Düsseldorf ist wirklich total schlecht geworden immer diese Wiederholungen“
Na, wer von den Kollegen aus der Branche hat „Bingo!“ gerufen? Der Satz stammt aus dem Automaten für pauschale Medienkritik. Ich muss immer etwas schmunzeln, wenn ich den lese. - „Phil Collins und James Blunt wohnen in einer Zweier-WG mitten im Studio“
Das ist nur die halbe Wahrheit. Andreas Bourani wohnt in der Zweier-WG noch zur Untermiete 😉
Ich kann die Kritik an der Musikauswahl eines Radiosenders verstehen. Aber eine Wette: Wenn alle Kritiker aus der Facebook-Diskussion ihre Lieblingstitel auflisten würden, finden wir mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Ihre einzige Gemeinsamkeit ist die Kritik an der Musikauswahl des Radios. Ich bin aber auch froh, dass es diese Kritik gibt. Wie schlimm wäre es, wenn bei jedem Song eines Senders alle Beifall klatschen würden.
Es gibt aber eine Menge Leute die Tag für Tag gerne ihr Radioprogramm einschalten. In Deutschland wird noch immer sehr, sehr, sehr viel Radio gehört. Auch wenn man als Wort-Redakteur manchmal die eigene Arbeit als das Maß aller Dinge hält, muss ich zugeben: Das liegt auch an der professionellen Arbeit der Musikredaktionen.
Foto: Shutterstock / Dark Moon Pictures
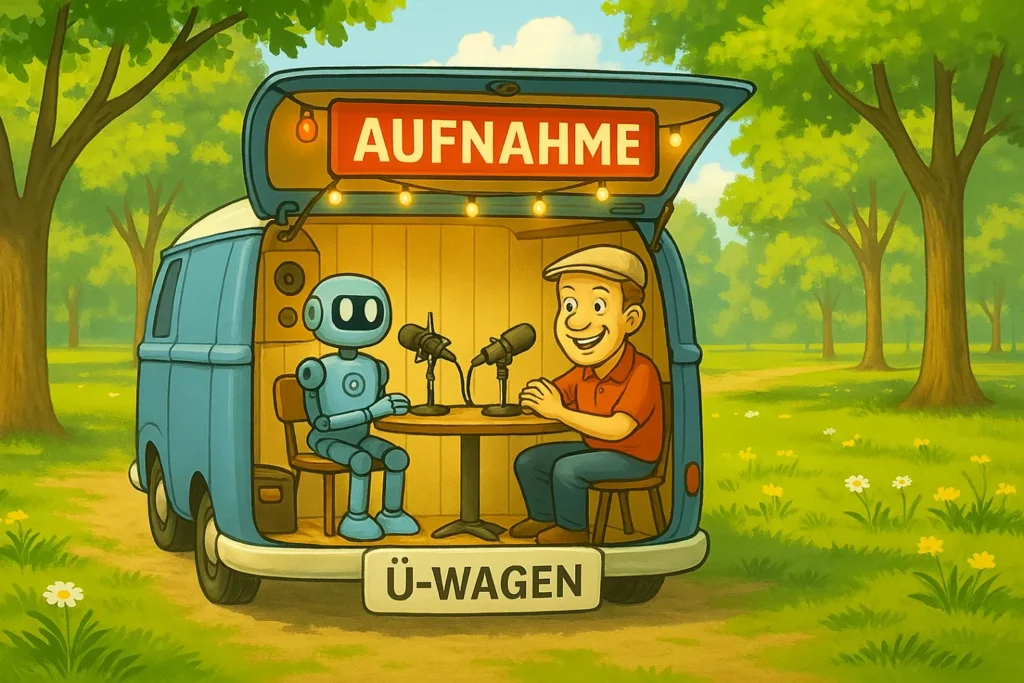

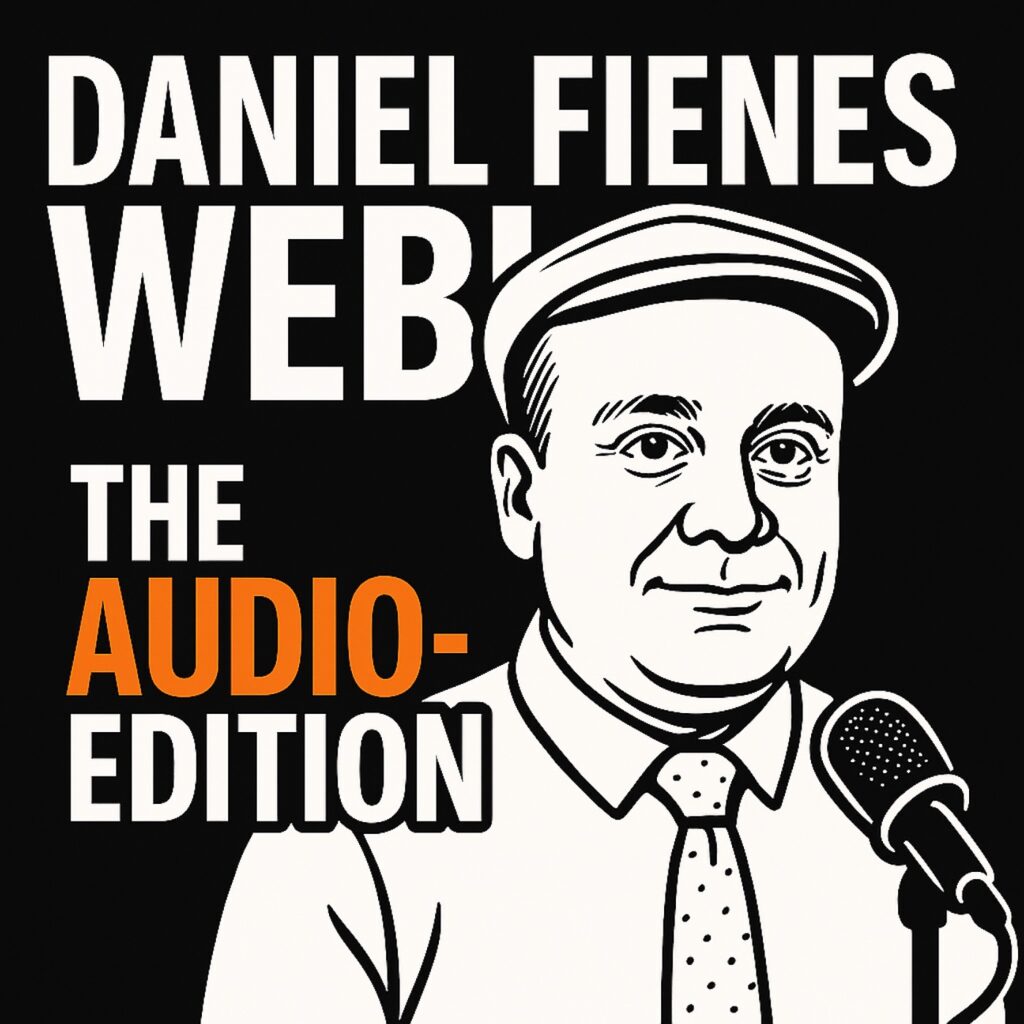
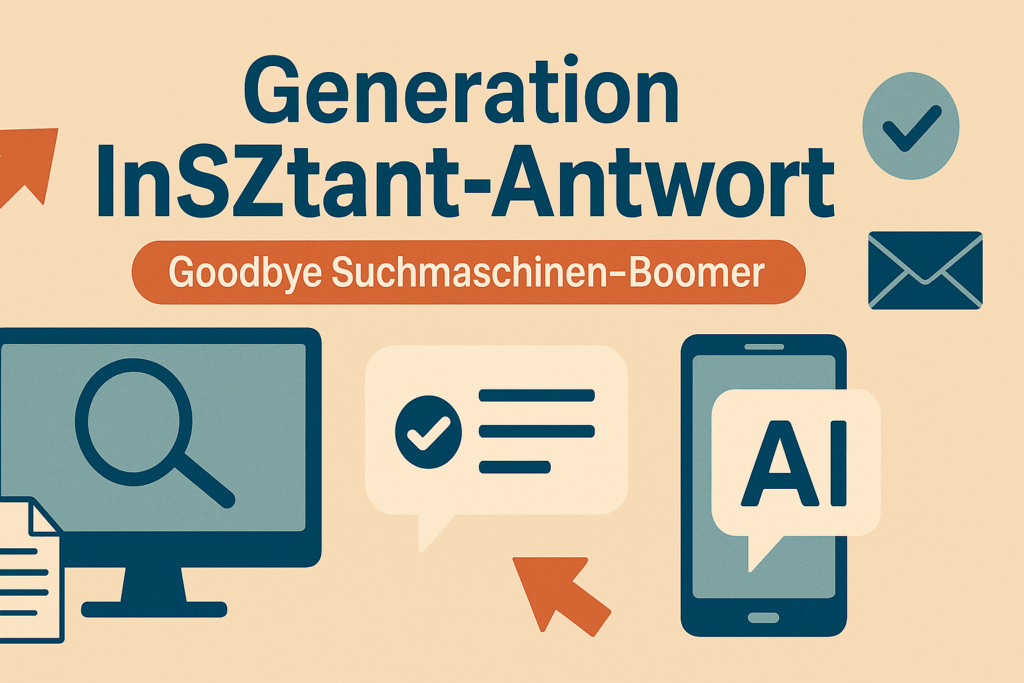

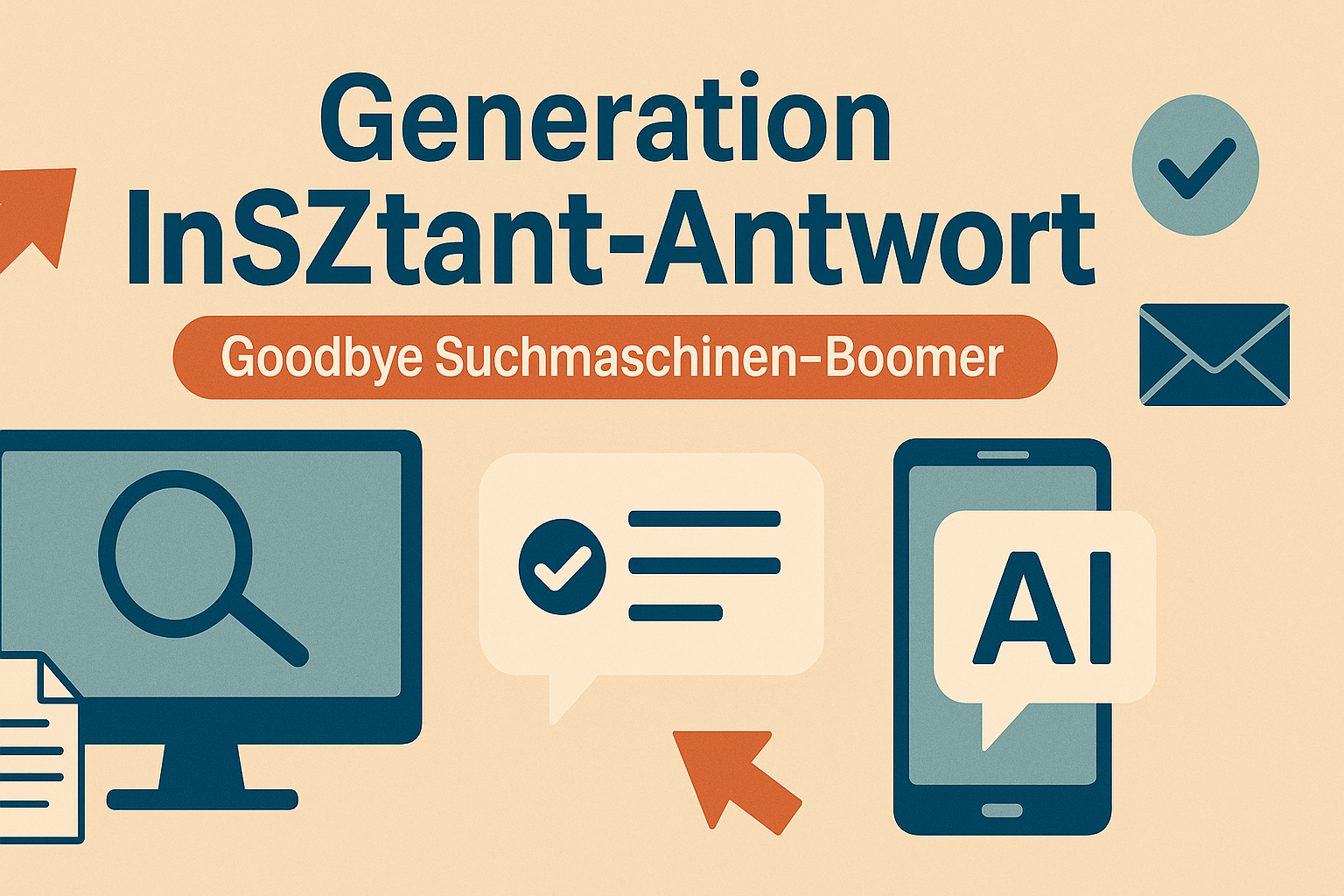
Vielen Dank für Deine professionelle Erklärung, der unterschwelligen Wahrnehmung von uns Radiohörern. Sehr gut erklärt und geschrieben. Da kann man nur den Hut ziehen.
Olaf Wegner
Lieber Olaf, vielen Dank – das freut mich sehr! Da aht sich die Mühe ja gelohnt. Lieber Gruß, Daniel
Hallo Daniel, bis vor ein paar Jahren hätte ich in den Klagechor miteingestimmt. Aber ich musste leider feststellen, dass mein Musikgeschmack nicht massentauglich ist. Meine Arbeitskollegen lieben einfach die Musik von Radio WMW (unser Antenne Düsseldorf), selbst meine Kinder finden mit Abstrichen die Musik gut. Wenn ich eine andere Musikfarbe möchte, gibt es in NRW einige Alternativen. Da ist z. B. 1Live Plan B, oder DLF Nova, oder auch WDR Cosma zu nennen. Außerdem gibt es in Zeiten von Internetradio mehre Alternativen. Ich höre sehr gerne reine Wortprogramme unterbrochen von dem Anhören meiner eigenen Spotify/Deezer Playlist.
Viele Grüße Marco
Der wirkliche Grund ist , die öffentlich rechtlichen Sender in Deutschland müssen für jeden Song GEMA Gebühren bezahlen , die Privaten nicht . Musikredakteure gibt es schon lange nicht mehr , die Kosten ja Geld . Also nimmt man einen Stick mit 1000 Songs die angeblich gefragt sind und spielt diese im Zufallsmodus jeden Tag ab . Noch billiger kann Radio machen von Flensburg bis Garmischt doch nicht sein .
Zum Glück gibt es Dank der Kollegen und Kolleginnen von Byte/Ego/radio1 und FluxFM noch Alternativen, bei denen nicht die Masse bestimmt was läuft, sondern wirklich Musikredakteure ((So viel zu Punkt 1) – also Leute, die von guter Musik wirklich etwas verstehen und bei denen abseits des Mainstreams Künstler/innen gespielt werden, die es bei anderen Formaten niemals durch Hörerabfragen schaffen würden.
Nun lieber Daniel, es freut mich das du dich so intensiv mit der gängigen Form, der Musikplanung beschäftigt hast. Als gelernter Musikredakteur stimme ich deiner Beschreibung zu. Jedoch bin ich auch analytisch tätig, hier muss ich dich auf einige Dinge hinweisen, die selbst „erfolgreiche“ Sender nicht berücksichtigen. Zum ersten ist Musicresearch nur bedingt zur Ermittlung von Hörervorlieben geeignet, da es wissenschaftlich keine Belege für tragfähige Ergebnisse gibt (siehe dazu die Studie von Holger Schramm, Peter Vorderer, Annekaryn Tiele and Simon Berkler; Thema „Music Tests in Commercial Radio Research“) hier wird unter wissenschaftlichen Bedingungen die These widerlegt, das Music Research in der dort praktizierten Form (Auditoriumstest) funktioniert. Anders sieht es mit Burn Out Studien aus die Aufschluss darüber geben wann Song seine Akzeptanz für den Hörer verliert und er aus der aktuellen Rotation genommen werden muss. Insofern ist diese Form der Musikforschung durchaus eine Geschäftsmodell, das von einigen wenigen Researchfirmen angeboten wird, die es verstanden haben ihre Dienstleistung als unverzichtbar zu positionieren. Hier wird viel Geld verdient, mit freundlich gesagt, fragwürdigen Ergebnissen. Zudem ist es auch durchaus unterschiedlich inwieweit und in welcher Form diese Ergebnisse ins Programm einfliessen. Weil du den Berliner Markt ansprichst, rs2 hat trotz siebenstelliger Investitionen in Research und Beratung zwischenzeitlich schon einmal fast die Hälfte der Hörer verloren, warum? Wenn Musik Haupteinschaltfaktor ist, der Research korrekt durchgeführt und die Ergebnisse akkurat umgestzt wurden? Und ja es wird an Manpower in der Musikredaktion gespart, bei der RTL Gruppe in Berlin kümmert sich ein Musikredakteur um alle Programme. Was bei einer Rotation von 200-400 Titeln, je nach Format, nicht schwer ist. Wirklich erfolgreich Musicresearch betreiben übrigens gerade Amazon, Spotify, Google und Co. Deren Verkaufsschlager Alexa oder Google Home ermöglichen den Internetriesen Zugriff auf unsere individuellen Musikvorlieben, mit dem Ergebnis das in kürzester Zeit Algorithmen bessere virale Angebote für jeden Nutzer erstellen werden als dies einem Musikredakteur möglich ist. Also ist es an der Zeit darüber nachzudenken, wie wir als Radio dagegenhalten können, meine These lautet, immer stärker reduzierte Playlists können nicht die Antwort sein 😉 Ich finde das Music Research ein Hilsmittel sein kann jedoch nicht, wie viel zu häufig praktiziert, Musikredaktion erstzen kann.
PS kann dir ein Abstract der Studie gerne zukommen lassen, sie wurde übrigens Mitte der 2000er wiederholt mit deckungsgleichen Ergebnissen.
Hallo, Daniel!
Interessante Lektüre. Ich könnte jetzt zu vielen Punkten etwas schreiben, aber dann wäre der (Arbeits-)Tag vorbei 😉
Somit beschränke ich mich mal auf den Punkt 4. Dort heisst es:
„Dann ist die Chance sehr groß, dass dieser Song bei dem anderen Sender eher wieder gespielt wird, als bei dem alten Sender. “
=> Und da liegt doch zumindest ein Hase im Pfeffer.
Wenn ein Sender beispielsweise die „Simple Minds“ auf ihr „Don’t you (forget about me)“ limitiert (oder Madness auf „Our House“, die Liste ist unendlich…), dann ist das wohl so, wie du schreibst. Wenn ich aber auf dem einen Sender Hit Nr.1 der Simple Minds höre und auf dem anderen Sender mal den etwaigen zweiten Hit (und es gibt viele), dann wäre mir das deutlichst recht…
Doch es sind immer die immergleichen 08/15-Songs, die sich von Sender zu Sender erstrecken – und nur selten gibt es mal positive Ausreisser. Wenn doch, dann erst nach 21 Uhr…
Das finde ich so unendlich schade, dass verdiente Bands und Künstler oftmals auf einen oder zwei Songs limitiert werden, die dann wiederum von vielen Sendern auch noch verstümmelt werden, damit sie ja ins Schema passen. Das ist das, was ich dem heutigen Mainstream-Musikradio am allermeisten vorwerfe…
Gruss aus Gütersloh!
Die quälend andauernde Kritik am Formatradio (= formatiertes Musikradio) nervt. Das kann sich die Generation des Überflusses leisten, die von allem genug hat � und davon noch zu viel.
Mal davon abgesehen, dass privates Musikradio marktwirtschaftlichen Regeln folgt, um erfolgreich zu sein. Ich sehe Musikradio im historischen Kontext. Zu Beginn meiner musikalischen Sozialisation gab es (wenn überhaupt) ein x pro Tag eine Radiosendung, die die Musik spielte, die wir hören wollten. Die Babyboomer und die direkt nachfolgenden Kohorten wären damals glücklich gewesen, hätte es die Mainstream-Musikradios von heute damals schon gegeben. Die mussten auf AFN, BFBS etc. ausweichen.
Heute gibt es die Dauerberieselung mit dem Mainstream � und die Hörerzahlen zeigen, diese wird goutiert. Die heutige Kritik am Formatradio ist meckern auf hohem Niveau.
Ich kann mit dem heutigen Mainstream in der Musik nicht mehr viel anfangen. Heute habe ich aber im Vergleich zu früher, zig Möglichkeiten via Radio (UKW, DAB+, Internet) meine Musiklust auszuleben.
Musikradio im 21. Jahrhundert � wie geil ist das!
Man kann schon lange kein Radio mehr hören in NRW, egal, ob Lokalfunk oder WDR.
Ich weiche schon lange zu den Holländern und Belgiern aus, die können wenigstens Radio und Abwechslung !
Auf DAB+ höre ich das Schwarzwaldradio und komischerweise hat genau der Sender immer mehr Zuhörer, die fast durchgängig alle dasselbe sagen und schreiben : ENDLICH mal ein Sender, der nicht immer nur den besten Mix mit den besten Hits spielt.
Und sorry, dass Sie Ihr Metier hier verteidigen und versuchen, zu erklären, ist nachvollziehbar, das würde jeder tun, aber vielleicht sollten Sie auch erwähnen, wem Antenne Düsseldorf gehört, nämlich Ihrem Arbeitgeber, der Rheinischen Post, genauso wie NE-WS 89.4, Radio, Neandertal, Welle Niederrhein, Radio 90,1…..
Und von Unabhängigkeit kann auch keine Rede sein, die Rheinische Post ist politisch alles andere als unabhängig oder neutral.
Der angesprochene Verein (Veranstaltergemeinschaft) ist ebenfalls alles andere als neutral, besteht er doch in jeder Stadt aus hohen Leuten aus Kirche, Kultur, Wirtschaft und natürlich Politik, die von Radio nicht die geringste Ahnung haben.
Die Marktführerschaft würde Antenne Düsseldorf auch nicht verlieren, wenn endlich mal mehr Abwechslung laufen würde, ich denke es wäre sogar umgekehrt und verlorene Hörer kämen zurück, denn nur gutes Radio hält die Marktführerschaft, was als einziger Lokalsender in der Stadt natürlich auch nicht sonderlich schwer ist, da ja auch politisch Konkurrenz mit allen Mitteln verhindert wird, wie Sie es ja auch erwähnt haben.
Ein Beispiel hierzu ist die (überflüssige) UKW-Frequenz 91,50 MHz in Heerdt.
Da haben es sich vor längerer Zeit doch einige Leute erdreistet, ein zweites Lokalradio für Düsseldorf aufmachen zu wollen (übrigens ist Konkurrenz die perfekte Voraussetzung, um sich mal wieder Mühe im Programm zu geben), alle Voraussetzungen nach dem 2-Säulen-Modell (VG+BG) waren erfüllt und plötzlich nach über 20 Jahren !! fällt Antenne Düsseldorf auf, dass ja angeblich im Raum Heerdt Empfangsprobleme bestehen würden.
Folge : nach aktuellem Recht hat der bestehende Lokalfunk als Erstes Anspruch auf freie Frequenzen bei Empfangsproblemen und die 91,50 MHz zugewiesen bekommen.
Schwups, schon war eine möglich freie Frequenz für die Konkurrenz verbrannt.
Es ist ja schon mehr als bezeichnend, dass die 91,50 MHz noch nicht einmal auf der Homepage von Antenne Düsseldorf auftaucht.
Um es kurz zu machen :
Für mich ist dieses verlogene Modell schon lange tot, und es wird auch weiter seinen Tod sterben, denn im heutigen digitalen Zeitalter hat man die Möglichkeit, sich seine Musik selbst zusammenzustellen und muss sich eben nicht mehrmals jeden Tag James Blunt, Bourani und Co. geben.
Denn genau das wird immer mehr Hörer abwandern lassen, was die formatierte Radiolandschaft aber auch heute selbst schuld ist, wenn diese ihr eintöniges eigenes Medium immer mehr in den Ruin treibt.
Ich hoffe, Sie fühlen sich hiermit nicht angegriffen, das ist wahrlich nicht meine Intention, aber ich finde, es muss auch mal nicht nur Erklärungsversuche und Lobhudelei geben, sondern auch mal meiner Meinung nach begründete Kritik an einem immer weiter kränkelnden System.
Freundliche Grüße aus Meerbusch
PS : Ein Kommentar sei noch erlaubt :
was der Hörer braucht, ist einen „Wow-Effekt“.
Den bekommt er aber bei der immer gleichen Musik nicht wirklich, eher bei Schätzchen die man schon lange nicht mehr gehört hat, bei Abwechslung eben.
Freundliche Grüße aus Meerbusch
Hallo Daniel
Schön zu sehen, auch in den Kommentaren hier bislang, dass es doch noch Menschen gibt die das System Radio verstehen und die Vorgehensweise dahinter sehen und vor allem diese auch mal nach außen tragen.
Ich selbst bin seit 17 Jahren im Radio unterwegs und aktuell bei Weltmarktführer für Sendeplanungs- und Playoutsoftware beschäftigt – da erlangt man auch das ein oder andere Wissen.
Vielleicht noch ergänzend – der Durchschnittshörer hört 15 bis 20 Minuten Radio am Stück – die Kunst der Planung ist es, zu jeder Zeit des Tages in einem Block dieser Zeit nur die Sings zu packen die den Sender wirklich ausmachen. Und hier kommen dann die Redakteure zum Einsatz das Regelwerk der Software (Um die von dir dargelegten Wiederholungen zur gleiche Tageszeit zu vermeiden), die Library und Kategorisierung (Wann sollte Song X in einer Kategorie mit niedrigerem Turnover verschoben werden?) und die Zielgruppe ( Wen will der Sender wirklich ansprechen?) im Auge zu haben.
Das erinnert an das magische Viereck der Wirtschaftlehre – teilweise gegensätzliche Ansprüche miteinander in Balance zu bekommen und vor allem dauerhaft zu halten…
Grüße
Wenn es nach Hörerumfragen geht , wer ermittelt die ? Also ich selber oder meine Verwandten und Bekannten haben noch Nie ein Anruf zur Ermittlung des Radiohörverhaltens bekommen . Diese Umfragen und Ergebnisse sind Fiktionen !!! Wie immer mal über den Tellerrand schauen , wie machen unsere Nachbarländer Radio . Kritik ist eine Kunst sie zu verstehen . Also muss ich dann wohl doch Dannmarks Radio 4 weiter hören .
Dudelradio heute, heisst EINFALT statt VIELFALT. Die Musikprogramme heute lassen ( im Tagesprogramm!) Neuerscheinungen vermissen. Überhaupt fehlen Überraschungselemente.
Musikprogramme dürfen heute nur noch �durchgehend� als Begleitprogramme konstruiert sein. Es könnte ja jemand um – oder ausschalten.,Da stelle ich mir doch lieber mein eigenes Musikprogramm zusammen. In den Funkhäusern geht heute die nackte Angst um. Ich habe als Moderator und Redakteur bei NDR 2 gearbeitet. Ich bin dort ausgestiegen, um nicht – wie die Hörer – selbst auch noch zu verblöden.
Wobei, die Hörer sind nicht blöd. Es sind die Macher der Musikprogramme.
Aber, keiner muss sich die Musiktapeten ja anhören.
@Ferienwelle Auch Privatradios zahlen GEMA/GVL, sogar die Bürgerradios/Offene Kanäle zahlen an GEMA/GVL, deine entsprechende Äußerung ist also falsch.
Und die Hörerumfragen gibt es auch. nur, weil keiner aus deinem Umkreis je befragt würde, ist kein Indiz dafür, dass sowas nicht existiert. Ich bin bspw. schon öfter (>5) befragt worden.
Alle Kommentare gelesen!Es ist schade,dass so ein Sender wie Antenne Düsseldorf einem Sänger Mars(Marcel-Richard Saibert) einen Interview-Nachmittag mitClaudia Monreal widmet,sein neues Album vorstellt und ihn,als Düsseldorfer nicht ein einzigesmal spielt!Das nennen unsere Freunde nicht gerade eine Unterstütung für Newcomer!Viel Leute,Freunde und Bekannte haben sich über dieses Forum gefreut,aber,es bringt nichts,wenn die Musik nicht gespielt wird!Große Enntäuschung für den Sänger!Grüße an Antenne Düsseldorf aus Düsseldorf
Sorry für meinen vorigen Kommentar,den ich ohne Brille und mit iPad geschrieben habe.Da springen die Buchstaben,wie sie wollen!Trotzdem bleibe ich bei der Meinung,dass man Newcomer spielen sollte!
Herzliche Grüße Saibert
Auch im Süden der Republik ist „Radio Deja-Vu“ aktiv.
Bei der Arbeit höre ich seit Februar Tag für Tag den selben M…
Ein Beispiel:
„Liebe auf Distanz“ von Revolverheld, seit einigen Tage auf dem Markt, schafft es in Antenne Bayern von 07:00 bis 17:00 Uhr tatsächlich sieben (in Worten SIEBEN) mal!
Entweder die Moderatoren hören andere Sender (was ich gut verstehen würde) oder die hören die eigene Sendung nicht.
Antenne Bayern, „Bayerns bester Musikmix“ Ich trau mich nicht nach dem Zweitbesten zu fragen.
Kiss Me von Rea Garvey wird auch nicht besser wenn man es zu Tode spielt.
Darüber hinaus werden „unheimlich wichtige“ Reportagen bis zu x-mal angekündigt, unterbrochen von den kurzen, mehrfachen Ankündigungen durch Einspielungen der Titel die demnächst kommenwerden.
Die Playlist auf der HP gibt nur einen Bruchteil dessen wieder was da tatsächlich gespielt wird.
Ein Zitat eines Arbeitskollegen:
„Sieben Milliarden Menschen leben auf diesem Planeten – fünf davon machen Musik“
Ich stand auch vor diesem Problem, ständig die gleichen Titel ob neu oder Oldies. Ich habe das Problem gelöst und mir ein Internet-Radio gekauft, jetzt habe ich etliche Stationen weltweit gespeichert die nahezu Not-Stop Music spielen und das auch mit weitaus weniger Unterbrechungen mit Werbung, Nachrichten und sonstigem sinnlosen Palaver. Ich höre Dutzende von Songs die ich hier seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gehört habe. Bayern 3, Antenne Bayern und Radio Charivari sind für mich ab sofort Geschichte. Mein Lieblingssender ist Radio Retro Cebu 103,5 Philippines.
Ich stand auch vor diesem Problem, ständig die gleichen Titel ob neu oder Oldies. Ich habe das Problem gelöst und mir ein Internet-Radio gekauft, jetzt habe ich etliche Stationen weltweit gespeichert die nahezu Not-Stop Music spielen und das auch mit weitaus weniger Unterbrechungen mit Werbung, Nachrichten und sonstigem sinnlosen Palaver. Ich höre Dutzende von Songs die ich hier seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gehört habe. Bayern 3, Antenne Bayern und Radio Charivari sind für mich ab sofort Geschichte. Mein Lieblingssender ist Radio Retro Cebu 103,5 Philippines.
willkommen im digitalen Zeitalter, wer es verpennt hat, kann jetzt einschalten. Frei nach Merkel „Das Internet ist fuer uns alle Neuland“.
Die herkoemmlichen Radio Sender werden auch noch eines Tages merken das niemand die Dauerberieselung von einem Titel der x mal innerhalb eines Zeitblocks gespielt wird, mehr will..
Heutzutage streamed man Musik selber, die andere zusammengestellt haben ohne nach irgendwelchen Statisiken zu gehen oder man hoert diese Streams.
Da kommt Deutschland auch noch an..irgendwann…
Ich verstehe nicht, dass es bei einigen Sendern einmal im Jahr die von den Hörern gestaltete Hitparade gibt, in der dann Titel landen, die man sonst nicht hört oder Lieder sehr weit vorne landen und auch diese wandern nach Ende der Hitparade wieder im Keller bis zum nächsten Jahr. Warum geht der Sender auch hier nicht auf den wirklichen Musikgeschmack seiner Hörer ein????
Vielen Dank für den ehrlichen Beitrag. Das ist leider ein sehr bekanntes Problem bei den großen öffentlich rechtlichen Radiosendern.
Mit besten Grüßen,
Daniela
Viele Radiohörer haben sich grundsätzlich von den öffentlich-rechtlichen Sendern zurückgezogen und boykottieren diese- die ARD sendet am Hörer vorbei! ARD-eigene Statistiken sind eindeutig geschönt und manipuliert! Bayern1 beispielsweise hat Hörer verloren und bekommt massenweise Proteste seit der Programmreform! Das Unverschämte ist, dass durch die GEZ, die der Hörer bezahlen muss, die unfähigen Programm-Chefs schalten und walten, wie es ihnen passt- AM HÖRER VORBEI! Der Radiohörer der ARD wird grundsätzlich als treudoofer Depp betrachtet! Schaut doch mal an, wie es anders geht: zum Beispiel alle ORF-Radiosender spielen ein anderes Radioprogramm- DAS, was der Hörer will! Viele ehemalige BR-Hörer sind zu Radio Salzburg abgewandert!
Nun, den Hörern jetzt zu unterstellen sie würden das alles ganz falsch sehen ist doch zu billig. Offenbar empfinden ja doch sehr viele Hörer (ich auch) so. Demnach liegt das Research ja voll daneben und im Übrigen kenne ich keinen Menschen der mal befragt wurde (selbiges gilt auch für sonstige, angeblich ja repräsentative, Umfragen).
Diese Antworten spiegeln eher die Arroganz der Sender wieder, nicht die Sender sind Mist, die Hörer sind es. Radiosender wollen und sollen Geld verdienen, ja. Aber da man ja bis auf wenige Ausnahmen mittlerweile auch bei den öffentlich rechtlichen Sendern mit Werbung bombardiert wird muss man sich nicht wundern dass die Leute eher zu iMusic, Spotify und Konsorten greifen.
Ich habe im Büro den ganzen Tag lang das Radio laufen und habe jeden Tag dieses „Und täglich grüsst das Murmeltier“ Gefühl.
Viele schalten das Radio bestenfalls noch wegen den Nachrichten, dem Wetter und den Blitzer-Warnungen ein. Ich steige jetzt auch auf Onlinedienste um. Denn Dein Beitrag hat mir deutlich gezeigt wie man den Hörer beim Radio sieht: Man nimmt ihn nicht ernst.
Da ich durch meinen Job sehr gut weiß wie heutzutage Musik produziert wird und Musiker bin, analysiere ich gerne die Songs, die gerade laufen.
Hier meine Empfehlung an Musiker die im Radio gespielt werden wollen:
1. Benutze nicht mehr als vier Akorde in deinem Song
2. Verzichte auf verzerrte Gitarren
3. Benutze kein echtes Schlagzeug in der Aufnahme
4. Spannende E-Bass Läufe vermeiden
5. Verzichte auf instrumentale Melodien
6. Vermeide neue, ungewöhnliche Sounds
7. Lass bloß keine Pausen im Gesang
8. Benutze keine Instrumente die mit Mikrofonen aufgenommen wurden
9. Sei keine Band
10. Lass dich am besten von einem anderen Künstler featuren
11. Mische den Track so, wie alle anderen Songs im Radio klingen
12. Benutze Autotune
13. Mastere deine Musik so laut wie möglich
Also, bitte schön beachten für den Erfolg 😉
Achtung – dies gilt nicht für Oldies aus den 70er/80er/90er
Interessanter Beitrag, aber leider in vielen Punkten an der Wirklichkeit vorbei. Bei allen Sendern steht Wirtschaftlichkeit ganz oben auf dem Programm, Diversität und Kreativität kommen leider viel viel später. Das ist der Grund für alle die „Probleme“ im modernen Radio und warum wir uns vor Werbung, lachhaften 1 Minuten Nachrichtensendungen und einer Music Rotation aus gefühlt 15 Songs nicht mehr retten können. Es gibt bei den größeren Sendern fürs junge Publikum KEINE moderierten Sendungen mehr (dieser produzierte Comedy-Mist a la Tanke Anke usw. zählt nicht, auch das inhaltslose Gefrotzel vieler Moderatoren-Duos am Morgen ist für mich keine Sendung).
Dass das alles der Hörer selbst verschuldet glaube ich nur bedingt. Ja, die Masse will morgens vor der Arbeit nicht mit schweren Themen oder ihr völlig fremdartiger Musik belastet werden (1h afrikanische Musik morgens um 7.00 Uhr gefällig?). Das liegt an unserer immer engstirnigeren und oberflächlicheren Gesellschaft und Haltung. Genau da wäre es aber Aufgabe der Öffis Kontrastpunkte zu setzen (steht auch im Rundfunkvertrag), das Geld dazu haben sie ja sicher (GEZ), sind also nicht alleine auf Markterfolg angewiesen. Leider gibt es diese Überzeugung und diesen Arbeitsauftrag bei so gut wie keinem Sender mehr, da muss man schon ins Altherren-Radio wie Deutschlandfunk schalten. Die lächerliche Berichterstattung hatte ich schon erwähnt: Nachrichten von 1-4 Minuten Länge (Null Informationsgehalt, nur Schlagzeilen a la Bild raushauen, dafür aber teils jede halbe Stunde, damit der Werbeblock wieder zulässig ist). Mini-Beiträge von unter 5 Minuten in denen ein Thema benannt wird, aber niemals behandelt.
Die Music Research Umfragen sind einfach unrealistisch. Wenn ich beliebigen Hörern (und es sind ja bereits Hörer, sagt jemand „NEIN ich höre schon lange kein Radio mehr, weil“, wird gerade dieser Hörer ja NICHT weiter befragt) beliebige Titel vorspiele, einmal die abgenudelten Ohrwürmer a la Collins und dann die aktuellen Radio Top Songs (Sweet but Psycho) und dann noch einen aktuellen Song von Madeline Juno oder BTS anbiete, was werden über 80% der Hörer wählen? Richtig – das was sie kennen. Das ist menschlich und auch der Situation geschuldet. Eine Befragung findet ja nicht statt, wenn sich jemand auf eine gemütliche Stunde Radio Hören einrichtet, sondern adhoc, also immer zur Unzeit. Fremdes/Neuartiges wird von den meisten Menschen reflexartig abgelehnt (Selbstschutz), es erfordert mehr um sich auf neue Welten einlassen zu können. Dieser Weg ist den Sendern zu mühselig, das erfordert mehr Personal, mehr Fein Tuning, produziert auch mehr Fehlentscheidungen. Man geht den sicheren Mittelweg, nimmt die sicherste Wette. Und spielt eben im Oktober schon 6 Mal am Tag Last Christmas. Weil es „die Hörer“ ja wollen.
Man schaue mal in die Top-Charts der Streaming Portale, was die Masse so hört (inzwischen hören mehr junge Menschen Streaming Music als Radio). Ich bin da nicht begeistert und sehr froh, dass nicht 30 Mal am Tag Capital Bra und Apache 207 im Radio laufen, aber dass die dort NULL Mal gespielt werden ist unfair und stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Dass Nachwuchskünstlern, gerade aus Deutschland keinerlei Plattform geboten wird im Radio ist ein kulturelles Armutszeugnis, egal ob Songwriter, Pseudo-Gangster-Rap oder Dubstep. Musik ist Vielfalt und Freiheit. Radio ist das inzwischen kleinste Schlüsselloch der Welt um mit Musik in Berührung zu kommen und Offenheit, Interesse und einen eigenen Geschmack entwickeln zu können (die Recommendation in Streaming Diensten ist da gleich an Platz zwei, die macht genau den gleichen Fehler).
Dass man als Casual Hörer gefühlt den gleichen Song jede Stunde hört, egal ob man den Sender wechselt oder nicht, und das jeden Tag, ist ein Fakt, der nicht auf Einbildung beruht. Der Job eines Musikredakteurs beim Radio ist heute nicht herausfordernd, sondern eintönig und blutleer. Das Ganze ist leider ein Zeichen unserer Zeit, im Fernsehen und anderswo sieht es ja nicht besser aus. Vielfalt macht Mühe, ich muss mir Zeit nehmen, eine Meinung bilden, auswählen. Dass das evtl. nicht populär ist mag sein, aber dass sich Kulturinstanzen wie Radiosender ihrer eigentlichen Aufgabe verweigern, ist nicht akzeptabel. Radio ist nicht nur zur Dauerbeschallung da.
Gibt es denn eine öffentliche Statistik darüber elche Lieder wie oft gespielt werden ?
Dass würde recht schnell Gewissheit schaffen wie häufig einzelne Lieder gespielt werden.
Der deutsche Musik-Hörer ist weltweit einzigartig.
Die Medienlandschaft hat ihn dazu erzogen, dass er deutschsprachige Musik ablehnt – obwohl er von den englischsprachigen Texten nur das versteht, was er verstehen will.
Deutsche, die im Ausland leben – auch kurzfristig (Urlauber) – zwingen die Mediengestalter, dass nur noch deutschsprachige Lieder gespielt werden dürfen.
Ich selbst mache mir mein eigenes Programm.
Der Text bestätigt doch nur, dass die Masse an Sendern die gleiche Musik immer wieder spielt. Er liefert nur den Grund. Schade, dass nicht auf Vielfalt gesetzt wird.
Mittlerweile fliegt bei mir auch DLF Nova raus…. Die Vögel scheissen täglich mehrmals von Himmel….
Gefühlte Wiederholungen sind schlimm, gemessene Wiederholungen sind schlimmer.
Einfach die Playlist crongesteuert mit curl abgreifen und in eine Datenbank packen. Und dann sehen wird im Klartext und empirisch gemessen, dass es praktisch jeden Tag auf 1Live und WDR2 Titel gibt, die fünf Mal am Tag wiederholt werden, und weitaus mehr Titel, die vier Mal am Tag laufen.
Bei den fünffachen Wiederholungen gilt offenbar ein Interval von grob 4h Pause zwischen den Wiederholungen.
Bei WDR4 hingegen laufen Titel in der Regel nicht öfter als zwei Mal täglich.
Auf Deutsch: ein recht kleine Anzahl von Titeln macht einen erheblichen Teil des Musikaufkommens beim WDR-Rundfunk aus. Die Eintönigkeit ist real, nicht gefühlt
Musikgeschmack ist das eine, was mich vom Radio wegführt. Das viel Schlimmere ist die STÄNDIGE WIEDERHOLUNG des Sendernamens mit „Der Beste Mix aus BLA…BLA…BLA“. Diese ständige Eigenwerbung kotzt mich noch viel mehr an. Über die Pseudonachrichten möchte ich mich hier nicht weiter auslassen. Es bleibt nur noch das Internet, wo ich mehr Auswahl habe, ohne pseudo-fröhliche Moderatoren. Radio in jetzigem Mainstream-Format kann meinetwegen ganz verschwinden.
Aus Gewohnheit schalte ich manchmal das alte Autoradio ein, vorwiegend sind regional bedingt SWR und HR empfangbar. Völliges NoGo sind für mich all die popmusiklastigen Verkehrssender mit ihrem unerträglichen Mix, der sich seit 30 Jahren kaum veränderte. Ich werde noch wahnsinnig, wenn ich ein einziges Mal auch nur eine Sekunde lang Simpley Red oder andere „Evergreens“ hören muß.
Noch weniger verstehe ich, wieso ö.r. GEZ Sender Werbung bringen. Laut Intendanz „weil es Verträge gibt“. Ich vermute dahinter eher ein bewussten Impuls zur Gewöhnung der Menschen an Werbung generell. Unerträglich. Die „info“ Sender bringen keine normalen Informationen mehr, sondern ständug aufgeregen Politaktivismus aus der äußerten linksgrünen Ecke, als wäre das Mainstream. Wir kann man dann nonstop US-Pop bringen, die immergleiche „Musik“ mit leicht variierten Geräuschen?
Es gibt hervorragende liebevoll zusammengestellte Musiksendungen der echten Kultursender, hr2, swr2, und wdr 5 und ndr haben da auch was drauf!
Was ich schon immer fragen wollte: Wenn Radiosender ihre Radiosendungen hochladen und als Podcast zum Download anbieten …… warum fehlen darin die während der Sendung gelaufenen Musikbeiträge?
Das Schlimmste an Radiosendern wie Antenne und auch WDR2, 1live, SWR3 und co sind die Moderatoren. Ich stelle mir immer vor, dass die im Alltag auch mit dieser aufgesetzten guten Laune reden. Sehr lustig. Am allerschlimmsten die total überzogene Begeisterung der Sportmoderatoren beim Fußball.
Grau-en-haft
Als professionelles*_in Redakteu*_rin sollten sie wissen, dass es keinen Sinn ergibt „Sinn machen“ zu verwenden.
Wir im Allgäu haben zwei neue DAB+-Sender bekommen.
„Radio Fantasy“ spielt nur aktuelle Hits, die sich alle in etwa gleich anhören. Beispiele: Lost Frequenzies, David Guetta, Alle Farben usw. Da gibt es keinerlei Vielfalt. Es ist alles die gleiche Soße, der gleiche Beat, die gleiche hektische Musik. Nicht mal eine Ballade wird zwischendurch gespielt, geschweige denn ein anderer Stil. Mit meinen 58 Jahren bin ich anscheindend nicht mehr geeignet für diese neue Musik-Einfallslosigkeit.
Der zweite neue Sender heißt „Seefunk-Radio“. Dort heisst es mehrmals im Jingle „Die beste Musik aus 4 Jahrzehnten“. In Wirklichkeit sieht es aber so aus, dass zu 99 % genau die 80ger Jahre Songs gespielt werden, die echt kein Mensch mehr hören kann, weil sie schon auf zig anderen Sendern total abgenudelt worden sind. Ich frage mich sowieso, warum es immer nur die 80er sein müssen. Bei Oldies gehören für mich unbedingt auch die 60er und 70er dazu, und zwar nicht nur immer die selben Lieder.
So wie diesen beiden Sender sind leider die meisten anderen auch. Ich sehne mich oft in die 70er/80er zurück, als Radio noch richtig gut gemacht wurde. Da gab es richtig moderierte Sendungen, Specials mit Neuvorstellungen, Oldies, Musikrichtungen und vieles andere. Von Menschen (meist den Moderatoren selbst) ausgesuchte vielfältige Musik, die nicht aus dem Zufallsgenerator kam, die angesagt und über die gesprochen wurde.
Hoffentlich erkennt das irgendwann mal jemand und macht wieder ein richtig gutes Radio, so wie früher. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Man kann mir sagen was man will.Ich mag aufgrund der ständigen Wiederholungen und dem Abspielen der immer gleichen aktuellen Musik kein Radio. Weil meine Mitarbeiter aber immer „ihre“ Lieblingssender wollen, höre ich es notgedrungen. Bei 80er Jahre Hits höre ich immer mal ganz gern hin, Aber alle Sender haben bei den 80er oder 70er eine Band und eun Lied immer dabei -und ich meine auch alle Sender-:
Queen – I want to break free- und -Radio Gaga-
Warum höre ich seit vielen Jahren immer nur Queen?
Radio ist nur noch eine reine Katastrophe, schlimmer wie die Werbung in der Glotze, der ganze Bullshit kommt zich mal am Tag, da bekommt man keinen Ohrwurm mehr sondern schon Kopfschmerzen & schlechte Laune.. & das zu Beginn des Tages, Radio ist wie die Glotze ein Lächerlicher Lügenverein !!!
Dann die ganzen Idioten noch dazu die der Regierung bis zum Anschlag in den Arsch kriechen & deren Hochverrat schön reden diese kleinen Pisser, diese dreckigen Mittäter die sich wegen Beihilfe am Hochverrat mehr als nur Mitschuldig machen, vor das Exekutionskomando gehört & abgeknallt werden sollte, diese Fotzen !!!
Fühl dich ruhig angeschprochen Sie lächerlicher Haufen einer Schande !!!
Ehml. Soldat des 2. & 3. Panzerflugabwehrkanonenbattallion 131 Hohenmölsen
Interessante Einblicke, jetzt verstehe ich besser warum mich die Musik im Radio nervt. Ich habe früher viel WDR5 gehört, aber mittlerweile höre ich kein Radio mehr, das wurde bei mir durch Podcasts und Spotify ersetzt. Bei WDR5 fehlt mir die inhaltliche Tiefe, die es halt nur bei langen Podcasts gibt. Die Musik bei den großen Sendern fand ich schon immer schrecklich, aber das ist halt Geschmackssache, mein Geschmack ist halt nicht massenkompatibel. Bei Spotify läuft immer mein Musikgeschmack.
Was mich ärgert ist das es im UKW Bereich keinen Rock Sender gibt, man braucht ein DAB Radio um z.B. Radio Bob oder Rockantenne zu hören.
Ich bin zufällig auf diesen Beitrag und den sehr interessanten Diskussionsverlauf gestoßen. Dabei habe ich ein extremes Déjà-vu, da ich vor wenigen Wochen gewagt habe, den NDR2-Redakteuren mittels der neuen NDR2-App meinen Unmut über die ständigen Wiederholungen und die langweilige Musik mitzuteilen. Die erste Antwort war, dass ich völlig falsch läge und aggressiv sei (was ich definitiv nicht war). Immerhin war man aber bereit, mit mir zu telefonieren, wobei der mich anrufende Redakteur das Gespräch nach 25 Minuten (!) mit dem Satz beendete: „… deine Arroganz kotzt mich an…“ und dann ohne Gruß auflegte.
Zuvor hatte ich meine Kritik an ständigen Wiederholungen und der kleinen Grundgesamtheit gespielter Titel geäußert, die auch über einen sehr langen Zeitraum kaum durchgemischt wird beziehungsweise durch neue Titel aufgefrischt wird. Hinzu kommt, dass langjährig agierende „Oldie“-Bands auf wenige Titel reduziert werden, die immer wieder gespielt werden, bis man sie nicht mehr hören kann. Das gilt für z. B. Supertramp, Queen, Rolling Stones (wenn sie denn mal gespielt werden) und viele andere.
Interessant ist, dass der anrufende Redakteur in seinem Erklärungsversuch letztlich bestätigte, was auch hier in der Diskussion anklingt:
Der Sender versucht, in kurzer Zeit wieder erkannt zu werden, weil der durchschnittliche Hörer nur 15 – 20 Minuten das Radio einschaltet. Um das zu schaffen, müssen die immer gleichen Lieder mehrmals am Tag so gespielt werden, so dass man die kurz vorbeifliegenden Hörer einfängt. Darüber hinaus äußerte der Redakteur den denkwürdigen Satz „Manchmal müssen wir einen Titel 150 mal spielen, bis die Hörer ihn kennen.“ Auf meine Rückfrage, warum das denn sein müsse, antwortete er, dass doch gute Lieder den Hören bekannt gemacht werden müssten. Ich denke vielmehr, dass interessante, gute Lieder von sich aus so spannend sind, dass sie eine Reaktion beim Hörer hervorrufen. Da muss man nicht 150 mal in kurzer Zeit wiederholen. Das ist eher die Dosis, die auch gute Lieder zum Überdruss werden lassen.
Warum werden nicht über die Tageszeit bestimmte Schwerpunkte verteilt, so dass eben nicht auch in kurzen Zeitintervallen die immer gleichen Lieder zu jeder beliebigen Tageszeit zu hören sind? In meiner Jugend gab es „meine“ Musik nur mittags während einer halben Stunde, die Sendung nannte sich „Nach zwei im Zwoten“. In anderen Stunden liefen eben andere Schwerpunkte.
Ich höre aber dennoch gern öffentlich-rechtliche Sender, weil dort Nachrichten und auch Magazin-Beiträge etwas hochwertiger und ausführlicher gestaltet sind als bei Privatsendern (Bild-Zeitung Niveau). Auch ist hier im Norden zumindest zumindest der Anteil von (noch?) Werbung angenehm gering. Es geht anscheinend! Aber die Musik ist oft zum Weglaufen, wenn man – wie ich – circa 5 – 6 Stunden am Tag das Radio anhat, mal nebenher, mal mit voller Konzentration. Da kommt es sehr wohl vor, dass man auch ältere Titel vier mal am Tag hört („Jerusalema“, „Sonebody that Iused to know“, „Aiko Aiko“, …). Obwohl einmal für einen persönlich schon zu viel ist.
Abschließend vielleicht ein Wort zu den Umfragen:
Die sind auch aus meiner Sicht nur schein-repräsentativ und Geldverschwendung, dazu ist aber weiter oben sehr vieles wichtiges gesagt. Sie dienen eher als rechtfertigendes Feigenblatt für diejenigen, die ihre Arbeit verteidigen müssen, weil sie sie nicht selber machen. Ergebnis ist letztlich, dass das, was viel gespielt wird, bekannt wird, und Bekanntes wird viel gespielt.
Eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Was nicht bekannt ist, aber sein soll, wird eben so lange wiederholt, bis es bekannt ist.
Mehr vom Gleichen – Paul Watzlawik lässt grüßen….
Und das, was andere sagen bzw. machen, kann ja nicht falsch sein, wenn alle es so machen. Zum Selbstmachen und Anderssein gehört Mut, man kann scheitern, man kann aber auch dabei wachsen und besser sein als die andern.
Auch ich warte darauf, dass die Musikauswahl besser, interessanter, kurzweiliger und spannender wird.