Was ich total gerne mache: Mit Kolleg*innen zusammen ihre digitalen Projekte ordnen und dann ein passendes Geschäftsmodel entwickeln. Meist steht ein Blog oder Podcast im Mittelpunkt, aber dann gibt es auch die über die Jahre dazu gekommenen Social-Kanäle, einen Newsletter und irgendwie eine Community. Das alles zu sortieren und jedem Kanal somit auch einen Zweck zu geben, ist für die Kolleg*innen immer ein wertvoller Moment. Auf einmal hat alles seinen Platz, die Arbeit ist klar definiert, man hat sich von einigen Dingen (endlich) getrennt oder vielleicht etwas neues (endlich) dazu genommen. Auch das Produkt ist klar und dessen Nutzen für die Community. Ich helfe, das alles von einer Flughöhe aus zu ordnen. Im Duo packt man das große Ganze. Vor ein paar Tagen hatte ich noch gedacht, das ist einer dieser guten Momente. Immer wieder. Sowohl für den Kollegen, als auch für mich.
Leser-Interaktionen
Tipps
Auf nach Berlin

Diesen Text schreibe ich mit zwei Gefühlen, die gegensätzlicher nicht sein könnten: Trauer und Freude. Nach 13 Jahren werde ich Düsseldorf und die Rheinische Post verlassen. Im neuen Jahr geht es für mich nach Berlin: Ich werde dann das „Media Pioneer“-Team von Gabor Steingart verstärken. Ich darf Teil des spannendsten deutschen Medienprojekts werden. Aber der Reihe nach.
2006 hatte ich meinen ersten Praktikumstag bei Antenne Düsseldorf. Seitdem gab es kaum einen Tag, an dem ich nicht für die Rheinische Post Mediengruppe im Einsatz war. Freier Mitarbeiter, Volontär, Redakteur, der Wechsel zur Rheinischen Post. Entstanden sind „Die Sendung mit dem Internet“, viel Social-Media, das Listening-Center, eine Podcast-Offensive, viele neue Formate rund um das wunderbare Audience-Engagement-Team. Aber nach 13 Jahren ist meine Lust auf etwas Neues riesig!
Deswegen freue ich mich, ab Januar nach Berlin zu wechseln. Meine Aufgaben bei Media Pioneer werden in zwei Bereichen liegen. Einmal werde ich weiterhin als Leiter redaktionelle Digitalstrategie / Head of Audience Development bei der Entwicklung von neuen digitalen Formaten helfen. Dann werde ich wieder stärker inhaltlich arbeiten: Mit den Kolleginnen und Kollegen wollen wir im ersten Halbjahr ein regelmässiges Tech- & Trends-Format rund um Digitalwandel und Innovationen auf eure Ohren und in eure Inboxen bringen. Ich bin fest überzeugt: Ein optimistisches, neugieriges, konstruktives aber auch sortierendes Format können wir in der Technologie-Berichterstattung in Deutschland gut gebrauchen.
Worüber ich mich natürlich auch (meistens) freue: Ich arbeite wieder mit Michael Bröcker zusammen. Der neue Chefredakteur von Media Pioneer versucht mich noch von einer Neuauflage unseres Bröcasts zu überzeugen. Wir werden sehen.
Was ich euch aber sicher versprechen kann (ich erwarte schon die Frage): Herr Pähler und ich werden weiter jede Woche in „Eine Stunde Was mit Medien“ bei Deutschlandfunk Nova neugierig auf den Medienwandel blicken. Für mich ist das Format seit 2004 jede Woche eine persönliche Fortbildung und unsere Liste mit Ideen und Themen ist noch lang.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den vielen lieben Kollegen in Düsseldorf bedanken — auch an die Chefs, die Dinge möglich gemacht haben, die alles andere als selbstverständlich sind. Dadurch sind journalistische Angebote möglich geworden, auf die wir alle heute stolz sein können.
Jetzt geht es auf in ein neues Abenteuer.
Danke Düsseldorf, Hallo Berlin!
Copenhagen Coffee Lab gibt im Medienhafen auf
Am Halloweenabend habe ich eine traurige Szene beobachtet. An der Bushaltestelle Erfstraße steht ein Auto mit dänischem Kennzeichen. Davor steht ein Mann, spielt mit seinem Schlüssel und blickt Richtung Ladenlokal. Dort verlässt ein anderer Mann das Café, schließt früher als üblich hinter sich die Tür, blickt noch mal rein und schließt noch ein zweites Mal rum. Beide steigen stumm in das Auto und fahren weg. Zurück bleibt dieser Zettel:

Und wieder gibt ein Laden an diesem Standort auf. „Was ist denn nur mit der Hammer Straße 17 los?“ bloggte ich Anfang Februar 2018, als Vorgänger Yaz schloss.
Die Reihe der Misserfolge wird länger und länger:
Bis Ende 2012 / Anfang 2013: Der Starbucks Grand Bateau.
2013-2014: Miamamia, Café aus Essen
2014-2016: Tapasbar Bodega 17
2016-2017: Yaz – eine Prise Orient
Hier könnt ihr noch mal die Historie der Hammer Straße 17 nachlesen. Jetzt reiht sich nach knapp 15 Monaten das Copenhagen Coffee Lab ein. Aber warum?
Immerhin hatten die Backwaren eine außerordentliche Qualität, der Kaffee stark wie in Skandinavien und auf jeden Fall die besten Croissants der Stadt. Aber leider insgesamt zu teuer und von der Inneneinrichtung für die Preisklasse nicht liebevoll genug.
Das größte Problem ist aber meiner Meinung nach ein anderes: Das Coppenhagen Coffee Lab hat sich weder in die Community vor Ort integriert, noch eine neue Community aufgebaut. Das Relationship-Management war mangelhaft.
Kein Social-Media, keine persönliche Ansprache, keine Gründe um im Freundeskreis über Copenhagen Coffee Lab zu sprechen. Bei jedem Besuch fühlte ich mich wie ein Gast, der das erste Mal in einen Laden in einer fremden Stadt besucht.
Der einzige Grund, worüber in den letzten Monaten immer mal wieder gesprochen wurde: „Hat das Coppenhagen Coffee Lab im Hafen noch auf?“ — Seit heute wird die Frage mit „Nein“ beantwortet.

P.S.: Danke an Mr. Düsseldorf für den Hinweis.
5 Dinge, die ich kürzlich über das Podcasting gelernt habe
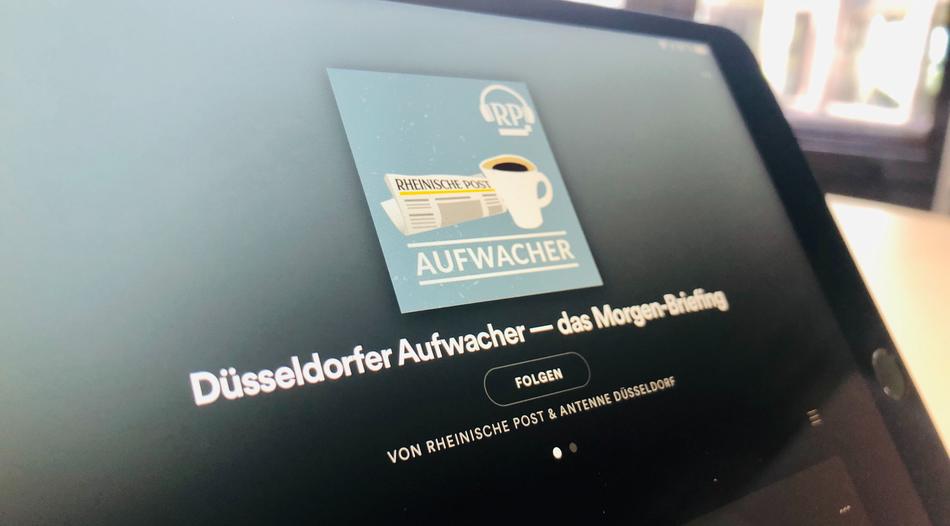
Vor drei Jahren haben wir bei der Rheinischen Post den Aufwacher gestartet. In zehn Minuten hört ihr, was in der Nacht geschah und am Tag wichtig wird. Wir blicken auf die Nachrichtenlage in NRW, Deutschland und die Welt – mit einer leichten Regionalfärbung aus Düsseldorf. Mit unserem Morgen-Podcast waren wir sogar vor The Daily der New York Times im Netz. Okay, zugegeben: Bei einem Podcast-Quartett wäre das der einzige Punkt, bei dem man mit dem Aufwacher die The Daily Karte stechen kann. Bei uns im Team ist der Aufwacher unser Lieblingsformat. Die Hörer schicken Fanpost, viele Kolleginnen und Kollegen bieten von sich aus Themen an. Wenn in der Mittagskonferenz über Aufmachung und Kommentare der Zeitung gesprochen wird, geht es auch um das Topthema im Podcast. 15.000 Nutzer hören täglich — für ein Angebot von einem regionalen Medium ist das eine gute Zahl.
Vor ein paar Wochen haben wir in allen unseren Podcast-Formaten eine Hörerumfrage durchgeführt. Wir wollten nicht nur erfahren, wann und wie unsere Audio-Angebote gehört werden, sondern, was die Hörer gut und schlecht finden. Über 1000 Hörerinnen und Hörer haben mitgemacht. Beim Aufwacher wurden am Häufigsten zwei Dinge an uns heran getragen: Wenn möglich soll der Aufwacher früher erscheinen (bisher zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr) und die Hörer wünschen sich auch mehr Nachrichten aus der eigenen Stadt. Den Wunsch haben viele Hörer zwar gemeinsam, doch meistens wohnen sie in unterschiedlichen Städten. Wir haben eine Idee, wie wir trotzdem auf den Wunsch reagieren können. Deswegen starten wir heute eine zweite Edition: Den Düsseldorfer Aufwacher.
Wir starten eine lokale Edition: Mit dem Ende der Herbstferien gibt es den Düsseldorfer Aufwacher. Dafür kooperieren wir mit Antenne Düsseldorf. Die Kollegen hatten auch Pläne, einen Podcast zu starten und da haben wir innerhalb der Mediengruppe die Kräfte gebündelt und bieten ein gemeinsames Format an: Neben dem regulären Aufwacher können die Hörer nun auch eine Düsseldorfer Edition wählen (Links: RSS-Feed für dein Podcast-Programm / direkt bei Spotify öffnen). Darin übergeben wir an die Kolleginnen und Kollegen der Antenne Düsseldorf Frühschicht, die einen Überblick über die lokalen Nachrichten präsentieren. Wenn das gut ankommt, kann ich mir weitere Editionen in anderen Städten unseres Verbreitungsgebiets vorstellen.
Nach der Analyse der Podcast-Umfrage habe ich aber auch noch viele weitere Punkte gelernt. Hier teile ich fünf, die auch anderen Formaten helfen können:
Fünf Dinge, die ich kürzlich über das Podcasting gelernt habe:
1. Ein guter Podcast lässt sich in einem (guten) Satz erklären.
„Lasst uns ein Podcast über XYZ machen“ oder „Zwei Personen reden über XYZ“ (noch schlimmer „Zwei Männer reden über“) fallen oft in diese Zusammenhang. Um aus der Flut der Podcasts hervorzustechen, reicht es nicht mehr einfach „einen Podcast über XYZ“ zu machen. Oft frage ich bei den Köpfen hinter neuen Podcasts nach ihrem Erklärsatz und bin überrascht, wie unausgereift die sind. Meistens wird zwar die Macher- und Themen-Perspektive gedacht, aber selten die Hörer-Perspektive. Beim Aufwacher lautet unser Satz so: „In gut zehn Minuten erfahrt ihr werktags um 07 Uhr, was in der Nacht geschah und am Tag wichtig wird.“ Die Hörer wissen woran sie sind, die Struktur und das Konzept leiten sich davon ab und auch wie wir den Podcast bewerben. Wenn man es richtig gut macht, greifen die Hörer das Konzept von selbst auf und schreiben es in die Reviews im Podcast-Verzeichnis von Apple. Wenn die das von sich aus machen, hat man es geschafft.
2. Ein guter Podcast kann auch sehr kurz sein
In der ersten Podcast-Welle sollten Podcasts entweder gut eine halbe Stunde dauern (durchschnittliche Pendler-Dauer) oder richtig lang (1-3 Stunden). Aktuell sind auch kürzere Podcasts beliebt. Gerade tägliche Formate können es sich leisten, nur zehn Minuten zu dauern. Neue Funktionen in Podcast-Apps (die nächste Folge muss nicht mehr manuell ausgewählt werden sondern startet automatisch) und bessere Datentarife für Unterwegs-Downloads machen es möglich. Angebote wie Daily Drive von Spotify werden diese Entwicklung befeuern.
3. Ein guter Podcast hat ein kleines, festes Ensemble
Unabhängige Podcast-Projekte haben dieses Problem nicht. Dieser Punkt wird vor allem oft bei Medienhäusern diskutiert. Ich kenne die Diskussion aus Funkhäusern, aber auch aus Verlagen. Aus Dienstplan-Sicht macht es viel Sinn, wenn Podcast-Teams möglichst groß sind, um flexibel auf Urlaubs- und Krankheitsphasen zu reagieren. Auch beim Einsatz von freien Journalisten gibt es gute Gründe aus Orga-Sicht. Aus Hörer-Perspektive gilt aber: Je übersichtlicher der Kreis der Moderatorinnen und Moderatoren, desto stärker die Bindung an den Podcast. Neben einer festen Uhrzeit sind auch vertraute Stimmen wichtig, damit ein Ritual aufgebaut werden kann.
4. Gutes Podcast-Marketing nimmt mittlerweile die Hälfte der Zeit ein
Okay, das ist übertrieben. Aber nur etwas. Mit dem Veröffentlichen einer neuer Podcast-Episode ist es nicht getan. Es muss auch sehr viel Zeit in die Online-Begleitung gesteckt werden. Gerade in der Aufbau-Phase braucht es neben der Vorbereitung und Produktion gleichwertig viel Zeit um die Social-Media-Begleitung, Aufarbeitung von Fotos und Zitaten, Herausschneiden von guten Sequenzen und der Cross-Nutzung der Inhalte in anderen Artikeln umzusetzen. Das wird oft unterschätzt oder nicht mit einkalkuliert. Hier kann ich mich auch noch verbessern.
5. Podcasting ist immer noch zu kompliziert für potentielle Hörer
Über 60% der Aufwacher-Hörer lassen sich die neuen Episoden als Sprachnachricht via WhatsApp schicken. Ich war erst skeptisch, aber nach einer Testwoche sagte uns eine Hörerin: „Morgens im Bad kann ich euch nicht lesen, aber hören.“ Das zeigt mir: Das Potential für Audio-Formate ist riesig. Aber das Handling ist für viele Nutzer immer noch zu kompliziert. Sie lieben es, wenn es in Apps passiert, die sie sowieso benutzen. Sich extra mit einer Podcast-App auseinanderzusetzen ist für viele noch eine Hürde. Zwar ist schon vieles besser geworden, als im Vergleich zur ersten Podcast-Welle. Damals musste man seinen MP3-Player ja noch vor dem Verlassen des Hauses synchronisieren. Bessere Datentarife, bessere Smartphone-Apps oder Smartspeaker helfen der Podcast-Welt. Aber das Format ist immer noch nicht selbsterklärend. Da hilft nur erklären, erklären, erklären.
Dieser Text ist Teil meines wöchentlichen Newsletters gewesen. Neugierig? Dann hole dir eine wöchentliche Dosis Inspiration, Neuigkeiten rund um Medien und Internet.
Was kommt nach den WhatsApp-Newslettern?
Hinter den Kulissen wird in vielen Redaktionen gerade diese Frage diskutiert: Was kommt nach den WhatsApp-Newslettern? Im Laufe des Dezembers soll Schluss sein. WhatsApp erlaubt Unternehmen eine One-to-One-Kommunikation und möchte eine One-to-Many-Kommunikation unterbinden.
In meiner heutigen Kolumne in der Rheinischen Post kritisiere ich, dass Mark Zuckerberg in seiner Rede an der Georgetown University zwar die Meinungsfreiheit als höchstes Gut präsentiert, aber auf der anderen Seite Medien ihre Nachrichten künftig auf der gesellschaftlich hochrelevanten App nicht mehr präsentieren können.
Gibt es Alternativen? Leider nicht wirklich. Andere Messenger spielen im Alltag der meisten Deutschen keine übergeordnete Rolle. Auch wenn die Messenger-Alternativen interessante Newsletter-Funktionen haben, ist dies für Publisher daher selten interessant. Wir können nicht das Online-Verhalten unserer Nutzer erziehen, wir können nur dort präsent sein, wo sie sich aufhalten.
Dazu ein paar Fakten:
- Die Nutzung von WhatsApp hat in den letzten 12 Monaten in Deutschland noch einmal zugenommen. Wöchentlich sind 75% der Deutschen dabei (täglich 63%)
- 22% der Deutschen teilen Nachrichten über Netzwerke, Messenger oder Mail
- 16% der Deutschen nutzen WhatsApp für News (nur Youtube und Facebook sind stärker — Twitter und Facebook Messenger sind mit jeweils rund 5% abgeschlagen)
Was Facebook/WhatsApp sagt: Nicht viel. Lösungsansätze werden nicht angeboten. Bei ähnlichen Entscheidungen hat Facebook gerne den Grund angeführt, dass die User eine bestimmte Funktion nicht wollen. Im Fall der WhatsApp-Newsletter kann jeder Publisher aber zeigen, wie sehr die Nutzer den Dienst schätzen. Ich bin immer noch beeindruckt, wieviel unaufgeforderte Fanpost wir von den Nutzern auch mehrere Jahre nach der Einführung bekommen. Kollegen berichten ähnliches.
Was traurig ist: Das Aus der WhatsApp-Newsletter ist nach meiner Einschätzung kein explizites Vorgehen gegen Journalismus, sondern viel mehr ein Kollateralschaden, einer eigentlich nachvollziehbaren Strategie. Im Kontext der Marktmacht von WhatsApp dürfte es aber nicht soweit kommen.
Was eine Lösung wäre: Facebook hat für neue Dienste wie „Today in“ oder den „Newstab“ eine Registrierung von Nachrichtenanbietern durchgeführt. Den Publishern auf dieser Liste könnte WhatsApp auch für den Versand von Newslettern erlauben. Das würde dann auch auf den in meiner Kolumne diskutierten Grund einzahlen, warum Facebook überhaupt zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Warum es als Journalist nicht verwerflich ist, unternehmerisch zu handeln

Wir haben uns im Rahmen der „Digital Journalism Fewelloship“-Tour mit Community-Journalismus bei der jüdischen Zeitung The algemeiner beschäftigt, eine Diskussion mit Jeff Jarvis an seiner Hochschule geführt, den frisch mit einem News-Emmy ausgezeichneten Gründer des New York Times Visual Investigation Teams kennengelernt und uns von den Gründer von Civil den journalistischen Blockchain-Ansatz erklären lassen. Aber in meinem kleinen Tagebuch möchte ich heute ausgerechnet etwas von dem branchenfremden Programmpunkt festhalten: Der Art-Talk über Technologie und Marketing in der Kunst. In dem Gespräch sind mir viele Parallelen zu einer immer wiederkehrenden Frage im Journalismus aufgetaucht: Wie unternehmerisch müssen Journalisten denken? Gerade für freie Journalisten ist es ein Thema. Unternehmen wir einen kleien Ausflug in die Kunstszene.
Dienstagnachmittag, irgendwo in Tribeca, einem wunderschönen aber oft auch ein bisschen vergessenen Stadtteil im Schatten von SoHo und dem Financial District. Seit zwei Jahren gibt es hier den Spring Place, einen Members-Only-Club für die Kreativszene. Ein Ort der Begegnung, untereinander und mit Auftraggebern. Wir treffen auf die Kuratorinnen Roya Sachs und Elizabeth und den Düsseldorfer Kunst-Unternehmer Magnus Resch. Kontrovers diskutieren sie über den Einfluss von Marketing und Technologie auf die Kunst-Szene. Eine Diskussion zwischen Tradition und Moderne. Zwischen Alt und Neu. Zwischen Stillstand und Fortschritt.
Elizabeth Dee beschreibt, welchen Einfluss der Wandel von Print zum Digital-Journalismus bei der New York Times auf die Kunst-Szene der Stadt hat. Sie beklagt, dass aus den zwei Seiten am Wochenende nur noch eine halbe übriggeblieben ist. Früher war es Standart, dass jede große Ausstellung eine Rezension bekommen hat — heute eher ein Glücksfall. Für die Kunst- und Galerie-Szene sei es deutlich schwieriger geworden, sichtbar zu sein. Auch das zuständige Team bei der NYT sei inzwischen deutlich kleiner: Einige langjährige Journalisten sind in den 70ern – es wird kaum Nachwuchs in das Team zugeteilt. Der Grund für diese Entwicklung: Die Geschichten aus der Kunst-Szene bieten zu wenig Clickbait, meint Dee mit Verweis auf den digitalen Fokus der Times. Einige Galerien sind dazu übergegangen inzwischen sogar eigene Magazine zu veröffentlichen.
Was Journalisten von Künstlern lernen können
50 Prozent der weltweiten Kunsteinnahmen gehen an 25 Künstler. Die anderen 50 Prozent verteilen sich auf die Millionen anderen Künstler weltweit. Magnus Rech hat diese Zahlen aus einer Analyse mitgebracht, bei der es um eine Frage geht, die auch im Journalismus viele Freie umtreibt: Wie kann man von seiner Kunst leben?
Die Antwort: Es kommt auf das eigene Netzwerk an. Welche wichtigen Personen kennt der Künstler? Wer trägt die Arbeit des Künstlers weiter? Am Ende ist das Netzwerk relevanter als die Kunst an sich.
In der Journalusmus-Branche ist es ähnlich: Freie Journalisten sind auf das eigene Netzwerk angewiesen. Auch für festangestellte Journalisten spielt es eine Rolle. Trotzdem hat es immer noch „Geschmäckle“, wenn über „der Journalist als Marke“ oder unternehmerisches Handeln als Journalist gesprochen wird.
Warum sich die Ausbildung noch ändern muss
Natürlich folgt auch in der Kunstszene immer die Diskussion über Kommerz: Künstler wollen doch für ihre Kunst stehen, sie wirken lassen und sich nicht selbst vermarkten. Aber sind das am Ende die Künstler, die von ihrer Arbeit leben können? Nein, sagt Magnus Resch. Diese Sicht sei sehr romantisch. Sogar in der ganz alten Welt waren Künstler in Wirklichkeit Handwerker, die Auftragsarbeiten abwickelten.
Resch kritisiert, dass an den Kunstakademien dieser Welt zwar die Kunst den Studenten vermittelt wird, aber nicht sich selbst unternehmerisch zu vermarkten.
Interessanterweise sprach das auch Jeff Jarvis bei unserem Besuch der City University of New York an: In einer guten journalistischen Ausbildung werden viele Journalisten zwar darauf vorbereitet, wie sie als Freie arbeiten können – also wie man Redaktionen zum Beispiel Themen vorschlägt. Sie erhalten jedoch viel zu wenig Unterstützung, die neuen Wege zu nutzen, um selbstständig die eigene Arbeit sichtbar zu machen: Sei es auf Youtube, in einem eigenen Newsletter oder Blog in Zusammenspiel mit eigenen Events oder Büchern. Auch wenn diese Darstellungsformen alles andere als neu sind, ist der strategische Umgang häufig nur eine Randnotiz journalistischer Ausbildung.
Ähnlich wie im digitalen Journalismus hat auch die Kunstszene ein Problem mit sinkenden Einnahmen. Laut Resch sind in den letzten zehn Jahren 20% weniger Kunst verkauft worden. Zwar sind die Galerien und Ausstellungen extrem gut besucht, aber Kunst verkauft sich schlechter. Kunst hat ein Conversionproblem, stellt Magnus Resch fest. Die Leute sind da, kaufen aber nicht. Resch nennt als Grund die fehlende Transparenz im Kunstmarkt.
Interessant ist der Ansatz, den Roya Sachs verfolgt. Sie zeigt Kunst gerne an Orten, an denen Menschen diese nicht erwarten. Gute Kunst drückt für Sachs etwas aus und verleitet das Publikum zu einer Reaktion. Ihre Erfolgsformel: Am Ende des Tages, möchte das Publikum das Gefühl haben, Teil von etwas zu sein. Ein Gedanke, der sich auch auf die Medienwelt anwenden lässt, aber viel zu oft vergessen wird.
Hier geht es zum ersten Teil der Reise und einem Besuch bei Bloomberg: Auf das Timing kommt es an.
Schreibe einen Kommentar